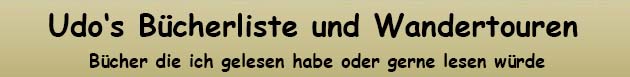Walz, Eric-Rezension
Antonia Bender 1 Die Glasmalerin
Trient im Jahr 1551: Die Stadt steht im Zeichen des großen Konzils, das in wenigen Tagen stattfinden wird. Das brisante Thema ist die Spaltung zwischen den Katholiken und den Lutheranern und es soll über einen möglichen Zusammenschluss der Kirchen debattiert werden. Doch kurz zuvor erschüttert ein Skandal die Stadt: Der alte Kardinal Bertani wird erstochen aufgefunden.
Der junge Jesuit Sandro Carissimi erhält zu seiner Überraschung den Auftrag, den Fall zu klären, obwohl er in Ermittlungsarbeiten bisher keine Erfahrung hat. Eigentlich arbeitet Sandro als Assistent für den scharfsinnigen und energischen Redner Luis de Soto, der bei dem Konzil die Seite der katholischen Kirche vertreten wird. De Soto unterstützt Sandro nicht nur bei den Ermittlungen, sondern reißt dabei auch die Aktivitäten zunächst an sich.
Schon bald stoßen sie auf einen Verdächtigen, den lutheranischen Redner Matthias Hagen. Matthias und Sandro verbindet seit vielen Jahren eine erbitterte Feindschaft und es ist für beide ein Schock, sich unter diesen Umständen wiederzutreffen. Zu allem Überfluss geschieht bald darauf ein weiterer Mord und Sandro gerät unter großen Druck. Und dann ist da noch die junge Glasmalerin Antonia Bender, für die Sandro mehr Gefühle entwickelt als ihm lieb ist …
Ein Jesuit ermittelt
Eric Walz’ Auftakt zu seiner Reihe um den ermittelnden Jesuiten Sandro Carissimi präsentiert sich als überzeugender Historienkrimi, der seine Leserschaft ins Trient des 16. Jahrhunderts versetzt. Es geht hoch her in jenen Tagen, das Konzil steht unmittelbar bevor und die Konflikte zwischen Katholiken und Lutheranern sorgen für Feindschaften und Entzweiungen. Ein Mord an einem Bischof ist das Letzte, was die Kirche jetzt gebrauchen kann und schnelle Aufklärung ist gefragt. Der junge Sandro Carissimi kommt wie die Jungfrau zum Kinde zu der Ermittlungsarbeit und tut sich dementsprechend anfangs alles andere als leicht damit, Erkenntnisse zusammenzutragen.
Faszinierende Charaktere
Zu den größten Stärken des Buches gehören die überzeugenden Figuren, die jede für sich eine interessante Hintergrundgeschichte mit einbringen. Sehr reizvoll sind die Verflechtungen der einzelnen Charaktere miteinander, die erst im weiteren Verlauf der Handlung alle deutlich werden. Da ist Sandro Carissimi, der nicht aus Berufung Jesuitenmönch wurde, sondern auf den letzten Wunsch seiner Mutter. Ganz vergessen hat er sein früheres weltliches Leben nicht und die Begegnung mit Antonia Bender trägt erst recht nicht dazu bei. Sandro erscheint als durchaus intelligenter Mann, der allerdings bisher in seinem Leben oft genug gescheitert ist und der sich mit den erfolgreichen Ermittlungen endlich einmal beweisen will. Mit Matthias Hagen verbindet ihn eine erbitterte Feindschaft, deren Hintergründe der Leser erst nach und nach erfährt. Der selbstbewusste Matthias ist ein undankbarer Rivale, war er doch in der Vergangenheit bereits stets überlegen und droht nun erneut, Sandro stolpern zu lassen. Besonders brisant ist die gemeinsame Verbindung der beiden zu Antonia Bender. Antonia ist von Sandro fasziniert und er ebenfalls von ihr, doch an eine Liebesbeziehung wagt natürlich keiner von beiden zu denken. Matthias Hagen wiederum ist Antonias Jugendfreund, den sie nun nach Jahren wiedersieht und zu dem alte Gefühle aufwallen, die offenbar erwidert werden – für Sandro ein weiterer Schlag und für Antonia ein komplizierter Zwiespalt, als sie vom Hass der beiden Männer aufeinander erfährt.
Eine wichtige Rolle spielt die Konkubine Carlotta da Rimini, Geliebte vieler Geistlicher in Trient und zugleich Freundin und Vertraute von Antonias Vater Hieronymus. Der alte, verwitwete Glasmaler ist ihr in großer Zärtlichkeit zugetan, was Carlotta dankbar erwidert, für Antonia ist sie eine mütterliche Freundin und ihr Beruf als Hure ändert weder für Antonia noch für ihren Vater etwas daran. Und dann ist da noch Innocento del Monte, der illegitime Sohn von Papst Julius III., der seit der Wahl seines Vaters kein mittelloser Gassenjunge mehr ist, sondern ein Kardinal. Wegen seiner einfachen Herkunft wird er von Teilen des Volkes verspottet, doch dahinter steckt ein komplexer Charakter, was auch Sandro bemerkt – nachdem er begriffen hat, dass Innocento derjenige ist, dem das Mordkomplott gilt.
Die Dramatik spitzt sich zu
Der Leser erfährt bereits auf den ersten Seiten, dass Carlotta plant, Kardinal Innocento zu töten. Das tut der Spannung dennoch keinen Abbruch, denn die Hintergründe werden erst recht spät aufgerollt. Interessant ist dabei vor allem, dass Carlotta keine Feindschaft gegenüber Innocento selbst verspürt, ja ihn nicht einmal kennt, sondern ihn nur als Instrument ihrer Rache benutzen will. Nachdem der Leser erfahren hat, was Carlotta einst geschehen ist und wem sie durch Innocentos Tod schaden will, begreift er ihr Vorhaben. Carlottas Schicksal ist tief bewegend, ihr Hass und ihr Wunsch nach Rache verständlich – doch zugleich ist Innocento ein sympathischer junger Mann, den man nicht sterben sehen will. Bis zum Schluss bleibt es spannend, ob Carlotta ihren Plan durchführen kann und will, was hinter den bereits durchgeführten Morden steckt und welche Rolle Sandro spielen wird – nicht zu vergessen natürlich auch die Fragen, was aus Antonia und Matthias, der Feindschaft zwischen Matthias und Sandro sowie Sandro und Antonia wird.
Nicht hundertprozentig überzeugen kann der Roman dagegen, was den historischen Bezug betrifft. Die Umstände des Konzils werden etwas vereinfacht dargestellt und die Historie der Handlung zuliebe etwas zurechtgebogen, auch was die Darstellung von Kardinal Innocento betrifft. Wer sich erhofft, im Roman nähere Informationen zum Trienter Konzil zu erhalten, wird sicherlich enttäuscht werden – der Hintergrund bildet lediglich die Folie für die Kriminalhandlung und das Schicksal der Protagonisten, ist aber nicht zur näheren Auseinandersetzung der wahren Geschehnisse gedacht. Das stört aufgrund der spannenden und unterhaltsamen Handlung kaum, bei falschen Erwartungen kann der Lesespaß allerdings getrübt sein.
Fazit: Ein gelungener Auftakt, der Lust auf die weiteren Bände der Reihe macht.
Antonia Bender 2 Die Hure von Rom
Mit "Die Hure von Rom" legt Eric Walz die Fortsetzung des 2007 erschienenen Romans "Die Glasmalerin" vor. Die "Hure von Rom" erzählt die Geschichte um Antonio Bender und Sandro Carissimi weiter, die sich zwar lieben aber doch nicht zueinander finden können. Diese Liebesgeschichte zwischen einem Geistlichen und einer lebenslustigen, unabhängigen Frau ist eingebettet in einen spannenden neuen Kriminalfall, welchen Sandro Crissimi lösen soll. Die Konkubine des Papstes wurde ermordet und in ihrem Sekretär taucht eine Liste von Verdächtigen auf, auf welcher Sandro, neben weiteren illustren Persönlichkeiten, auch seinen Vater findet. Sandro ist gezwungen nach langer Zeit wieder mit seiner Familie in Kontakt zu treten, und sich seiner Mutter und seinem Vater zu stellen. Seine familiären Schwierigkeiten und die Verständigungsprobleme mit Antonia treiben ihn in die tröstenden Arme des Weins, mit welchem er die Leere, welche er in sich spürt, zu füllen versucht. Bald jedoch geschieht ein zweiter Mord, diesmal an einem Mönch und die Verdächtigen sitzen in den höchsten Ebenen des Vatikans. Sandro ermittelt nun in zwei vollkommen unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus, dem der Huren und dem der Edelleute und Geistlichen, aber sind diese Gesellschaftsschichten wirklich so unterschiedlich oder sind die Grenzen zwischen Hochadel und Elend nicht eher fließend?
Sandro gerät immer öfter in Situationen, in welchen er sich gezwungen sieht, sich einer Partei im Vatikan anzuschließen und sich so dem Ränkespiel unten den Kardinälen unterzuordnen, seine Integrität steht auf tönernen Füßen und Antonia, die ihm eine Stütze sein könnte ist dabei sie erneut zu verlieben.
Der Autor versteht es ausgezeichnet den Leser immer wieder auf falsche Fährten zu locken, und ihn danach mit einer unerwarteten Wendung zu überraschen. Keiner der Beteiligten ist was er scheint und fast jeder führt ein doppeltes Spiel.
Spannung bis zum Ende in den Kulissen des Rom der Renaissance ist bei der Lektüre dieses Buches garantiert und eine Fortsetzung um Antonia und Sandro wird bereits angedeutet.
Es ist nicht notwendig den Vorgängerband Die Glasmalerin: Roman gelesen zu haben, um dieses Buch genießen und verstehen zu können, fehlende Informationen werden geschickt in den Text eingewoben, so dass dieser Band auch als einzelner Roman gelesen werden kann. Dennoch wird man nach Lektüre von "Die Hure von Rom" das Verlangen verspüren, zu erfahren, wie es mit Antonia und Sandro begann.
Antonia Bender 3 Der schwarze Papst
Eric Walz legt mit Der schwarze Papst bei seinen Kriminalromanen um Sandro Carissimi einen dritten Teil nach. Handelten Die Glasmalerin noch während des Konsils von Triest im Herbst 1551 vom geplanten Mord am Sohn des Papstes und Die Hure von Rom von dem unnatürlichen und vorzeitigen Ableben der Geliebten des Papstes Anfang 1552 im unmittelbaren Dunstkreises des Papstes, so beschäftigt sich der neue Fall nun um den Mord an einem Schüler der eben erst gegründeten Deutschen Schule des Jesuitenordens in Rom.
Wer aber könnte einen Grund gehabt haben, diesen jungen, vor wenigen Tagen erst aus Bayern angereisten Schüler umzubringen? Ging es dabei im Streit um die Gunst eines jungen Mädchens, der in tödliche Rivalität umgeschlagen war? Sollte der Schule bzw. dem Jesuitenorden an sich geschadet werden? Immerhin machten sich die Jesuiten bei den Mächtigen der Welt nicht gerade beliebt, waren sie doch ein Bettelorden, der sich für die Menschenrechte der Armen und Schwachen eingesetzt hat. Ein Dorn also in den Augen der Renaissance-Herrscher, die sich in einem Punkt absolut ähnlich waren: Sie liebten den Prunk und frönten der Verschwendungssucht, während ihre Untertanen kaum das Notwendigste zum Überleben hatten.
Fürchteten die alten Mönchs-Orden um ihren Einfluss und wollten so ihren neuen Widersacher in Misskredit bringen? Oder ging es gar um das ganze große Spiel an sich: Um Macht, um deren Erhalt oder deren Mehrung im Kirchenstaat?
Große Erzählkunst und viel kriminalistische Spannung
Eric Walz’ Erzählkunst ist bereits in seinen ersten Werken zutage getreten und trifft auch wieder auf diesen Roman zu. Die Figuren werden von ihm sehr sorgfältig eingeführt und vielschichtig beschrieben. Und so leben seine Geschichten immer von den Protagonisten, von den Handlungen und den ebenso liebevoll beschriebenen äußeren Umständen.
Der schwarze Papst profitiert als Kriminalroman noch mehr von diesem angenehmen und profunden Erzählstil. Das Ermittlerteam um Carissimi ist sehr scharfsinnig, und obwohl bereits nach wenigen Seiten überraschend einer der Mörder seine Maske gegenüber dem Publikum fallen lässt, so wird dadurch auch dem aufmerksamen Leser kein Stückchen der Gesamtauflösung gezeigt. Nur eben gerade so viel, wie es der Autor für notwendig erachtet, vielmehr noch, ist man als Leser doch aufgeheizt und glaubt der Auflösung des Rätsels nahe zu sein.
Der Spannungsbogen jedoch bleibt bis zum Schluss erhalten. Die Auflösung selbst ist zunächst sehr überraschend, wird aber mit den Gedankengängen, die Carissimi gegenüber dem Mörder erläutert – weil der natürlich selbst nicht glauben kann, dass dieser unscheinbare Mönch, der Visitator des Papstes, einfach so hinter die Gründe für diesen Mord gekommen sein konnte – zunehmend klarer.
Die heimliche Liebe zu Antonia als roter Faden zwischen den drei Carissimi-Bänden
Natürlich ist auch dieser Roman, obwohl als Teil einer dreiteiligen Romanserie angelegt, mühelos als Stand-alone zu verstehen. Man muss nicht die beiden anderen Bücher vorher gelesen haben, um die Protagonisten und deren Handlungsweisen nachvollziehen zu können.
Allerdings – und auch das ist oft bei den mehrteiligen Romanserien so – gibt es doch einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Bänden. Bei Der schwarze Papst ist es die heimliche Beziehung der Glasmalerin Antonia Bender und Sandro Carissimi, der sich seit ihrer Begegnung in Trient lieben, er sie jedoch als Jesuitenmönch nicht lieben darf und Milo, dem Sohn einer römischen Hurenhaus-Betreiberin, quasi dem lachenden Dritten, der im zweiten Teil mit Antonia anbandeln konnte. Zusammen mit Luis de Soto, Julius III., Hauptmann Forli und Angelo begegnet der Leserschaft eine ganze Menge alter Bekannter.
Eric Walz vollendet den vorliegenden Roman, wie bei fast allen seinen Romanen, mit einem Nachwort, in dem er erläutert, was historische Fakten und was Fiktion in seiner Geschichte darstellen, sowie einem Personenregister. Für die Fans von Sandro Carissimi und Antonia Bender lässt er offen, ob es möglicherweise noch einen weiteren Teil mit diesen Protagonisten geben könnte. Zu wünschen wäre es allemal.
Die Giftmeisterin
Historische Romane gibt es viele. Doch „Die Giftmeisterin“ lohnt sich, auch wenn der Titel meiner Meinung nach nicht ganz passt, immerhin steht nicht Fionee im Vordergrund, sondern ganz eindeutig Ermengard, die mit sich und ihrer Tat abrechnet. Natürlich spielt Fionee schon eine wichtige Rolle, aber es gibt durchaus andere, ebenso zentrale Figuren in diesem Roman.
Die Geschichte, die auf 410 Seiten in 60 Kapiteln erzählt wird, erzählt Walz aus Ermengards Sicht. Sie schreibt ihre Geschichte auf Pergament, und sie lässt sie in ihrem Haus herumliegen, nicht wissend, wer sie je lesen wird. Die Idee finde ich gut, weil man sich so als Leser angesprochen fühlt, wir sind ja nun quasi die Finder dieser Geschichte.
Ermengard ist eine sympathische Ich-Erzählerin, auch wenn sie den Fall um Hugos Tod am Ende dann für meinen Geschmack etwas zu Sherlock-Holmes-like löst. Zwar ist die Auflösung glaubhaft und nachvollziehbar, aber ich hätte es besser gefunden, wenn man als Leser auch auf die Lösung hätte kommen können.
Aber davon abgesehen ist es leicht, sich in Ermengards Situation hineinzufühlen. Sie liebt ihren Mann und möchte ihn nicht mit Emma teilen, auch wenn sie weiß, dass es gar nichts Ungewöhnliches ist, dass er eine Konkubine hat. Und „ganz nebenbei“ ermittelt sie auch noch in dem Mordfall, denn Ermengard ist neugierig und will dem Mörder auf die Schliche kommen.
Gut gefallen hat mir auch, wie Walz dem Leser Einblicke in das Leben der Konkubinen am Königshof gibt. Dabei sind alle Frauen, die im Frauenhaus leben, ganz unterschiedlich porträtiert und jede ist auf ihre Weise sehr interessant.
In der Erzählung gibt es zwischendurch immer wieder Rückblicke in Ermengards Vergangenheit. Diese beschäftigen sich zumeist damit, wie das Leben mit Arnulf früher war, und geben Einblicke in die Liebesgeschichte der beiden. So lernt man die Ich-Erzählerin nicht nur besser kennen, man versteht auch die Motivation für den Mord, den sie begeht.
„Die Giftmeisterin“ ist ein kurzweiliger, gut zu lesender historischer Roman und hat mir sehr gut gefallen.
Die Herrin der Päpste
Marocia hat in ihrem Leben vieles erlebt, vieles erreicht und vieles verloren: als Kind erlebte sie die Leichensynode und die Herrschaft Ageltrudis mit, die ihrem Vater zum Verhängnis wurde. Als junge Frau wird sie von ihrer Mutter an den Lateran „verkauft“ um die Hure des Papstes zu werden – nur damit ihre Mutter den Papst zum Freund hat. Später wird sie Herzogin von Spoleto, dann Königin von ganz Italien – nur um von ihrem Mann verraten und von ihrem Sohn eingesperrt zu werden. Sie verliert viele ihrer Kinder, denen sie nicht genug Mutter war. Und doch gibt sie nie auf und verhilft auch ihnen zu ihrem Glück – während ihres erst am Ende ihres Lebens zu ihr kommt...
Eins meiner Lieblingsbücher.
Die Geschichte spielt im Italien des 10. Jahrhunderts, in einer Zeit, in der Italien gespalten war und die Päpste von den Herrschern bestimmt wurden.
Eine sehr interessante Epoche, wobei ich nicht sagen kann, welcher der Personen im Buch wirklich gelebt hatten oder ob komplett alles fiktiv ist.
Auf jeden Fall ist es eine Geschichte, die fesselt, die man verschlingt.
Marocia ist eine unglaublich starke, aber auch egoistische Person. Für ihren Traum eines geeinigten Italiens, bleiben ihre Kinder auf der Strecke, was viele von ihnen ihr nicht verzeihen können – auch wenn sie ihnen im Hintergrund zu dem verhilft, was sie sich wünschen.
Die Personen im Buch sind bunt beschrieben, von intrigant bis liebenswert ist alles dabei. Dabei geht es um eine große Menge von Menschen, die man ihm Blick behält, allerdings verliert man nicht einmal die Übersicht, wer wer ist und was er warum tut.
Im Mittelpunkt steht aber immer Marocia und die ihr nahe stehenden Personen wie ihre Kinder, ihre verschiedenen (Ehe)Männer und ihre Gedanken.
Das Buch ist aus der Erzählersicht geschrieben, aber dennoch taucht man in die Gedanken- und Gefühlswelt der einzelnen Personen ein, vor allem natürlich Marocias.
Sie muss viel Leid durchmachen, man ist selbst das ein oder andere Mal schockiert über die Schicksalsschläge, die sie hinnehmen muss.
Auch die Gegegebenheiten sind sehr schön geschildert, seien es Feldzüge oder auch nur die Landschaften – man sieht alles vor seinem geistigen Auge.
Wer historische Bücher mag, macht hier sicherlich nichts falsch!
Fazit:
Wunderschön geschriebene, spannende fiktive Geschichte über die Päpste und eine starke Frau in einer männerdominierten Welt
Die Schleier der Salome
Vor zweitausend Jahren wächst die kleine Salome als Enkelin von Herodes dem Großen und Tochter von Herodes Boethos und seiner Gemahlin Herodias zwar wohlbehütet auf, weiß sich jedoch schon früh gegen die vorherrschenden Männer zu behaupten. Gerade Kephallion macht ihr ein ums andere Mal das Leben schwer, wurde sie doch von seinem eigenen Vater zum schulischen Unterricht zugelassen, was für Mädchen bislang nicht möglich war. Schon bald verliebt sie sich in den Griechen Timon, allerdings ist eine Verbindung der beiden schon aus Standesgründen nicht möglich. Doch immerhin freunden sie sich an, und auch Kephallion beobachtet dies argwöhnisch.
Salome findet sich allmählich in den Gebräuchen der Hochgestellten zurecht und lernt so auch Haritha kennen, die Frau von Herodes Antipas. Sie weiht Salome in die Kunst des Schleiertanzes ein, mit dem eine Frau alles erreichen kann, was sie will. Heimlich hat Herodes Antipas jedoch eine Affäre mit Salomes Mutter Herodias, und nach Harithas Tod nimmt er Herodias auch offiziell zur Frau. Als Timon vermeintlich durch Intrigen ums Leben kommt, sucht Salome nach ihm, bekommt jedoch keine Informationen und heiratet daher ihren Onkel Philippos. Erst Herodes findet Timon wieder, der inzwischen aus Gefangenschaft fliehen konnte und zu einem angesehen Architekten geworden ist. Salome erkennt dies und lässt ihn für ihren Mann die Stadt Philippi (später Caesarea) bauen, mit Timon als Architekt und geduldetem Liebhaber. Doch nicht alles in Salomes Leben verläuft so vermeintlich glücklich, den die Sekte der Zeloten, zu denen auch Kephallion gehört, gewinnt mehr und mehr Einfluss auf die Politik im Land, und auch eine Gruppe, die sich selbst Christen nennt und ihren Anführer hat kreuzigen lassen, gewinnt an Bedeutung.
Erzählungen mit viel Überblick
Eric Walz hat mit seinem großen, 700 Seiten starken Roman über die Tänzerin Salome einen eindrucksvollen Einblick in die Zeit des ersten Jahrhunderts neuerer Zeitrechnung vorgelegt. Von der ersten Seite an, die auf Salomes Geburt zusteuert, bis zur letzten Seite ist ihm ein bisweilen sehr spannendes Buch gelungen, das ihre Geschichte bis zur Vermählung mit ihrem zweiten Mann erzählt. Dabei schafft er es jederzeit, die teilweise sehr konfusen Verwandtschaftsverhältnisse der Familie zu erklären und auch die politischen Begebenheiten gut im Blick zu behalten.
Der Konflikt mit Kephallion wird logisch und konsequent von der Wurzel bis in den Schluß aufgebaut und erhalten, wenngleich in der Mitte des Buches diese Situation leider etwas in den Hintergrund gerät. Walz beobachtet dabei nicht nur die Geschichte Salomes, sondern auch die des gesamten Römischen Reiches mit all ihren Verwicklungen und komplizierten Hierarchien. Stets wird der Leser auf dem – möglichen – aktuellen Stand gehalten, was aufgrund der Entfernungen und der entsprechenden Kommunikation nicht immer einfach ist.
Die Charaktere sind alle liebevoll und eindrücklich beschrieben, gerade mit der verrufenen Haritha sympathisiert man leicht. Allerdings hätten die „Bösen“ Zeloten noch mehr Raum vertragen. Eric Walz hält sich fast nur auf der Seite Salomes und ihrer Familie auf, dabei hätte mehr Blickwinkel aus der anderen Seite dem Buch noch mehr Würze gegeben.
Einige Längen, aber spannende Erzählweise
Eric Walz hat aus den wenigen bekannten Fakten der Person Salomes einen Roman erdacht, der bekannte Geschichten wie die Enthauptung Johannes des Täufers mit Fiktion verbindet. Das ist als Autor eines Romans sein gutes Recht und füllt so manche bislang unbelegte Geschichtslücke. Dies macht er so logisch, dass man sich durchaus vorstellen kann, dass es wirklich so hätte sein können. Allerdings, und dies ist einer der wenigen Kritikpunkte des Romans, ergeht er sich dabei und überhaupt durch den ganzen Roman in langwierigen Erzählungen, die zwar alle mehr oder weniger interessant sind, letztlich aber nicht immer zum eigentlichen Geschehen beitragen. Diese Längen im Roman kommen immer wieder. Zwar verdeutlichen sie die Situation und das Leben vor Ort, allerdings hätte einiges eingespart werden können und so die Geschichte mehr Tempo bekommen können. Auch einige Jahreszahlen oder ähnliche derartige Hinweise hätten besser die zeitlichen Dimensionen aufgezeigt.
Davon abgesehen ist Eric Walz ein durchaus spannender Roman gelungen, der einen interessanten Einblick in die Zeit und das Leben von vor zweitausend Jahren gewährt. Zwei Karten, ein Personenregister und ein ausführliches und daher sehr ergiebiges Nachwort runden einen Roman ab, dessen Sujet bislang noch wenig beschrieben wurde. Walz’ zweiter Roman deutet allerdings bereits sein große Erzählkunst an, und das wünscht man sich von manch anderen Romanen auch.
Die Sündenburg
Wer hat den alten Grafen Agapet ermordet? Seine Tochter Elicia ist überzeugt, dass es ihre Mutter Claire war, die nur kurz nach dem Tod des Grafen ihren Geliebten Aistulf heiratete. Claire hingegen tut alles, um die Ungarin Kara, eine Sklavin, die mit dem Toten im Bad gefunden wurde, als Mörderin hinrichten zu lassen. Licht ins Ganze bringen soll der Vikar Malvin von Birnau aus Konstanz, der mit der Untersuchung des Falles betraut ist. Bei seinen Ermittlungen stößt der Vikar auf einige Ungereimtheiten und gerät immer tiefer in den Strudel der Ereignisse, der die beteiligten Personen erfasst hat. Undurchsichtig bleibt auch die Rolle der stummen Magd Bilhildis, die ihre eigenen Interessen verfolgt.
Ungewöhnlicher Aufbau
Autor Eric Walz greift für diesen Roman auf einen höchst ungewöhnlichen Aufbau zurück. Er wählt als Erzählweise die Ich-Form – und das gleich fünf Mal. Denn jede der Hauptpersonen bekommt eine eigene Stimme und kann damit die Geschichte aus ihrer eigenen Sicht erzählen. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen den Geschehnissen. Denn jede Person hat eine ganz andere Perspektive und letztlich auch jeweils ein eigenes Interesse an der Entwicklung der Dinge. Optisch sehr gut gelöst ist die sich verändernde Perspektive eine höchst reizvolle Komponente. Die Ich-Erzählweise – in historischen Romanen sonst eher verpönt – bringt hier eine wohlschmeckende Würze ins Geschehen.
Durch die Erzählstruktur gelingt es Eric Walz auch, die handelnden Personen in ihren Charakteren dezidiert auszuarbeiten. Der Einblick in die Gedankenwelt jedes Einzelnen macht es leicht, die Beweggründe für ein bestimmtes Handeln nachzuvollziehen und sich in die Person hinein zu versetzen. Dies, ohne dass jeder der fünf Charaktere wirklich sympathisch sein oder dessen Handlung goutiert werden muss.
Letztlich ist es auch der gelungene Aufbau, der die Spannung darüber, wer denn nun den Grafen tatsächlich ermordet hat, fast bis zum Ende hoch halten kann. Damit bekommt das Krimi-Element eine angenehme Note und trägt zum positiven Gesamteindruck einiges bei.
Krieg oder Brot
Ausgezeichnet versteht es der Autor, die unterschiedlichen Vorstellungen der Regenten darzustellen. Während sich Aistulf als neuer Graf um seine Bauern sorgt, die Hunger leiden und durch ein furchtbares Hochwasser geschädigt wurden, will sein Schwiegersohn Baldur (Elicias Ehemann) als Befehlsführer der Truppen auf Kriegszug gehen. Dieser Interessenskonflikt macht deutlich, unter welchen Zwängen die kleineren Herrscher standen, die ihrem König Gefolgschaft gelobt hatten. Und es ist ein fein strukturiertes Bild davon, wie die ständige Kriegsführung der Könige und Kaiser nicht nur den untergebenen Adel forderte, sondern ganze Landstriche ausblutete und am Hungertuch nagen ließ. Denn die rekrutierten Soldaten fehlten als Hilfskräfte auf den Feldern.
Aber auch das Leben auf der Burg kommt bei den Schilderungen von Eric Walz nicht zu kurz. In die Gedanken der Protagonisten eingestreut erklärt der Autor die Zusammenhänge auf eine leichtfüßige Weise und macht einerseits den Alltag sichtbar, andererseits zeigt er auch die für heutiges Verständnis skurrilen Beerdigungsriten auf. Alleine schon dafür lohnt es sich, sich vertieft mit dem Roman Die Sündenburg auseinander zu setzen.
Sorgfältig gestaltet
Bei diesem Roman haben Autor und Verlag Hand in Hand gearbeitet. Die Namen der unterschiedlichen Erzähler werden typographisch voneinander abgesetzt, ebenso die Verhörprotokolle von Malvin von Birnau. Weniger überzeugend ist das Cover, bei dem leider zu viele Zugeständnisse an den herrschenden Trend gemacht wurden, wobei immerhin darauf verzichtet worden ist, einen kopflosen Frauentorso aus einem alten Gemälde abzubilden.
Hier wird ein attraktiver historischer Roman vorgelegt, der von einer hohen Präsenz der Protagonisten lebt und viel Hintergrund bietet.