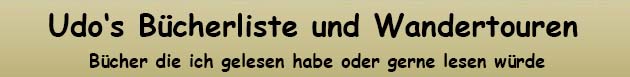Clarke, Arthur C-Rezension
Odyssee 1 2001 Odyssee Im Weltraum
Die Welt in einer fernen Zukunft. Die Menschheit hat das All erobert, Kolonien gegründet und eine interstellares Reich errichtet. In den Weiten des Weltalls stieß man auf fremde Wesen, die, wie kaum anders zu erwarten war, nicht alle friedliche Koexistenz auf ihre Fahnen geschrieben haben. Die insektoiden Til-Nara stehen den Menschen abwartend gegenüber, mit den verschlagenen Ruul, einer Nomadenrasse gab es bereits erste kriegerische Auseinandersetzungen.
Um der Bedrohung Herr zu werden, soll die Marine aufgerüstet, neue Kriegsschiffe in Dienst gestellt werden. Die TKS Lydia wurde als Prototyp der neuen Trägerschiffreihe entworfen und gebaut. Unter dem Kommando von Kommandant Vincent soll sie auf ihrer Jungfernfahrt auf Herz und Nieren geprüft und erprobt werden. Mit an Bord ein Agent des militärischen Geheimdienstes, eine zusammengewürfelte noch nicht aufeinander eingespielte Crew, der Sohn eines hochrangigen Admirals und ein Verräter.
Kurz darauf wird die Lydia von den Ruul erobert und dazu missbraucht, einen Konflikt zwischen Menschen und Til-Nara zu schüren. Die Ruul wollen, nachdem die beiden Rassen sich gegenseitige geschwächt haben, die Überreste hinwegfegen, und sich ohne Konkurrenz zu den Herren der Galaxie aufschwingen.
Doch noch geben sich die wenigen Überlebenden der Besatzung der Lydia nicht geschlagen – und, wie allgemein bekannt, ist ein angeschlagener Gegner ein gefährlicher Widerpart. Das müssen auch die Ruul leidvoll am eigenen Echsenleib erfahren …
Inhaltlich bleibt der Autor dem Gewohnten verhaftet
Sie mögen David Webers Honor Harrington, können Raumgefechten und Kommandoabenteuern etwas abgewinnen, sind gar Fan der so genannten Military-SF? Dann hat der Atlantis Verlag nach der Tentakel-Trilogie aus der Feder von Dirk van den Boom Nachschub an entsprechendem Lesestoff für Sie.
Inhaltlich wartet wenig wirklich Neues auf den Leser. Einmal mehr greifen fiese Alienaggressoren die Menschheit an, wird diese von Verrätern unterwandert und muss eine tapfere Crew an vorderster Front die Kampf gegen einen überlegenen Gegner aufnehmen. Das ist vom Ansatz her nicht neu, in der Umsetzung aber durchaus packend. Nach einem etwas langsamen Beginn, in dem uns der Autor seine Gestalten sehr ausführlich vorstellt, kommt die Handlung dann schnell mit der Enterung der Lydia in Fahrt. Danach schließt sich die Suche nach den Gründen, dem Verräter und schussendlich die Rückeroberung des Raumschiffes an.
Die Figuren selbst sind sympathisch gezeichnet, entsprechen dabei aber weitgehend dem gewohnten Bild. Der etwas skurril-weltfremde Erfinder, der abgeklärte Agent, der überraschend kompetente Sohn, dazu ein integrerer, allerdings vorliegend etwas blass bleibender Kapitän, das hält keine wirklichen Überraschungen für den Rezipienten bereit. Geboten wird spannend und abwechslungsreich aufgezogene Military-SF, die für Leser, die dieses Sub-Genre goutieren, eine echte Alternative zu dem darstellt, was die Großverlage bieten.
Rama 1 Rendezvous mit Rama
Im Jahre 2131 ist die Menschheit zwar vereint aber keineswegs einig. Im Rat der „;United Planets“ sitzen Vertreter der Erde, des Mondes, der Planeten Merkur und Mars sowie der Monde Ganymed, Titan und Triton: Das Sonnensystem ist bis zur Umlaufbahn des Uranus‘ besiedelt.
Die sieben Mitglieder der UP stellen auch das „;Rama-Komitee“, das seine Arbeit aufnimmt, nachdem ein gigantischer, offensichtlich künstlicher Himmelskörper gesichtet wird: Objekt 3¼39, später benannt nach der Hindu-Göttin Rama, ist eine Raumarche von zylindrischer Form, misst stolze 50 km in der Länge und weist einen Durchmesser von 8 km auf. Seit Jahrmillionen ist dieses Schiff unterwegs, dessen Kurs direkt auf die Sonne zielt.
Ist „;Rama“ bemannt? Hegen die Insassen feindliche Absichten? Nur ein Raumschiff ist in der Lage an „;Rama“ anzudocken, bevor die Arche das Sonnensystem – hoffentlich – wieder verlässt: die „;Endeavour“ unter ihrem erfahrenen Commander Norton. Obwohl für eine Mission wie diese in keiner Weise ausgerüstet oder vorbereitet, steuert die „;Endeavour“ den künstlichen Mini-Planeten an.
Das Innere von „;Rama“ ist eine in vielerlei Hinsicht auf den Kopf gestellte Welt -‚Städte‘ liegen auf der Innenseite des Zylinders, und ein gewaltiges Ringmeer teilt die Landfläche wie die Bauchbinde einer Zigarre. Tot und öde wirkt die Landschaft, aber das ist ein Irrtum. „;Rama“ erwacht und entlässt eine faszinierende Menagerie, die nicht ganz ungefährlich ist …
Die Zukunft außerhalb der Kristallkugel
„;Science Fiction“ ist ein Begriff, der erstaunlich selten seiner eigentlichen Bedeutung gerecht werden kann: Wissenschaft und Fiktion sollen sich in diesem Genre mischen, womit „;Wissenschaft“ die möglichst realitätsnahe Extrapolation bekannter und gesicherter technischer aber auch sozio-kultureller Aspekte einschließt. Das ist einerseits eine schwierige Kunst und andererseits ein Korsett, aus dem sich die meisten SF-Autoren schon früh befreiten. Sie ersetzten „;Science“ durch „;Technobabbel“ und gaben der „;Fiction“ den Vorzug.
Wunderbare Romane und Kurzgeschichten begründen die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens, zumal sich in den Jahren und Jahrzehnten der SF-Geschichte herausstellte, dass mindestens 99 von 100 Autoren mit ihren Zukunftsprognosen absolut falsch lagen. Wen wundert’s, und inzwischen denken nur wenige Zeitgenossen an eine Science Fiction, die von den Dingen kündet, die da kommen werden.
Wobei Arthur C. Clarke mit „;Rendezvous mit Rama“ zeigt, dass diese nüchterne Betrachtung zu differenzieren ist: Der Zeitfaktor spielt eine wichtige Rolle, wenn man in die Zukunft schaut. Je weiter dieser Blick schweift, desto unsicherer wird die Trefferquote. (Allerdings sinkt auch das Risiko erwischt zu werden: Wer die Gegenwart des 4. Jahrtausends schildert, ist vor persönlicher Haftung sicher ...) Gefährlich ist es außerdem, allzu sehr in Details zu schwelgen. Die Nähe zu naturwissenschaftlichen Grundregeln ist wesentlich hilfreicher als die ‚exakte‘ Beschreibung zukünftiger oder gar außerirdischer Kulturen.
Keine Angst vor dem ungelösten Rätsel
Clarke führt uns mit „;Rendezvous“ in die Königsklasse der „;Hard SF“: Er projiziert einerseits die technischen und kulturellen Gegebenheiten seiner Gegenwart – der frühen 1970er Jahre – glaubhaft in das 22 Jahrhundert, während er Rama, die Raumarche, und das Geschehen in ihrem Inneren nur beschreibt aber selten erklärt. Für die meisten SF-Autoren ist die Aufklärung aller aufgeworfenen Rätsel ein Fetisch, der gleichzeitig die Furcht vor einem Publikum beschreibt, das angeblich genau dies fordert und offene Fragen hasst.
Es bedarf schon eines selbstbewussten und talentierten Schriftstellers, um dies als falsch zu entlarven. „;Rama“ ist und bleibt ein Rätsel. Die Besucher von der Erde bemühen sich in Vertretung der Leser um Erklärungen, doch sie müssen sich eingestehen, dass ihre Schlüsse Vermutungen bleiben. Sie sind Fremde in einer fremden Welt, die sie mit mehr offenen Fragen verlassen als vor ihrer Ankunft. Selten wurde ratloses Stochern im Unbekannten so spannend als Plot genutzt.
Clarke bedient er sich einer nüchternen, einfachen Sprache, die er freilich mit demselben Geschick wie der Rattenfänger von Hameln seine Flöte bedient. Er schreibt ungemein plastisch; was geschieht, sorgt vor dem geistigen Auge des Lesers für die entsprechenden Bilder. Als versierter Verfasser von Sachbüchern, die sich an den astronomisch und technisch interessierten Laien wandten, wusste Clarke, wie sich komplexe Themen allgemein verständlich vermitteln lassen.
Das hat in der deutschen Fassung überlebt. In der ‚guten, alten Zeit‘ setzten deutsche Verlage auch auf Brot-und-Butter-Titel fähige Übersetzer an, die ihren Job nicht nur verstanden, sondern denen auch die Zeit zugestanden wurde, ihn ordnungsgerecht auszuüben. Ungeachtet der Frage, ob „;Rendezvous mit Rama“ 1975 für die deutsche Fassung gekürzt wurde – für Clarke ist beispielsweise Polygamie ein alltägliches Phänomen der Zukunft, was für den erschrockenen deutschen Michel womöglich etwas abgeschwächt wurde -, liest sich Roland Fleissners Übersetzung trotz ihres Alters frisch und flüssig.
Das Weltall ist ein Ort für Fachleute
Das perfekte Gleichgewicht zur Geschichte bilden die Figuren. Clarke wurde von der Kritik immer wieder für seine angeblich eindimensionalen und gefühlsarmen Handlungsträger gescholten. Vor allem in der Ära der „;New Wave“-SF und ihrer Betonung der ‚geisteswissenschaftlichen‘ Elemente einer zukünftigen Welt hatte es Clarke mit seinen zielstrebig vorgehenden, zumindest ‚im Job‘ sicher auftretenden Protagonisten nicht einfach. Doch hinter dieser Figurenzeichnung verbarg sich Absicht. „;Rendezvous mit Rama“ war Clarkes Gegenentwurf zum thematisch ähnlichen Roman „;Ringworld“ (1970, dt. „;Ringwelt“) von Larry Niven. Auch dieser hatte eine künstliche Welt entworfen, die er indes mit recht ‚menschlich‘ denkenden und handelnden Protagonisten besetzte: Die Ringwelt wird von einem Raumschiff be- und untersucht, dessen Besatzung sich mindestens ebenso intensiv um diverse Konflikte wie um die Forschungsarbeit kümmert.
Diese Mischung aus ‚harter‘ SF, Abenteuer und Seifenoper ärgerte Clarke, der nicht davon ausgehen mochte, dass die Raumschiffe der Zukunft von wankelmütigen Querköpfen gesteuert wurden. Folgerichtig zeichnete er die Besatzung der „;Endeavour“ primär als „;professionals“ und erst in zweiter Linie – aber ohne diese Tatsache zu vernachlässigen – als Menschen. Commander Norton und seine Begleiter sind durchaus Individuen und keineswegs zielorientierte Roboter, aber sie stellen den Job über ihr Privatleben und Teamwork über Einzelgängertum. So funktioniert Forschung, will Clarke damit ausdrücken, und das nicht nur in der Zukunft, sondern generell. Was innerhalb „;Ramas“ geschieht, ist interessant genug und muss nicht durch Liebeshändel, Blastergeballer oder ähnliche künstliche Konflikte aufgepeppt werden. Logisch und auf dem Boden sorgfältig dem Schauplatz angepasster Tatsachen treibt Clarke die Ereignisse entlang eines kräftigen Roten Fadens voran.
Kürze mit zeitloser Würze
Die Rechnung geht auf. „;Rendezvous mit Rama“ ist ein Roman von heutzutage erstaunlich anmutender Seiten-‚Stärke‘: 300 Seiten reichen voll und ganz aus, eine großartige Geschichte zu erzählen. Clarke hatte sogar noch raffen können; das Zwischenspiel mit der Rakete, die von den ängstlichen Merkur-Bewohnern gen „;Rama“ gefeuert wird, wirkt ein wenig aufgesetzt.
Aber auch hier beschränkt sich Clarke auf das Wesentliche. Moderne SF-Autoren vermögen viel zu oft die Tinte nicht zu halten – sie walzen jedes Detail unendlich aus und erzeugen Mehrteil-Abenteuer von Ziegelstein-Dicke. Clarke ‚überspringt‘ Handlungssequenzen, die für das eigentliche Geschehen überflüssig sind, weil sie nur der Vorbereitung dienen und sich in ein, zwei Sätzen abhandeln lassen. So geht es ohne Ballast-Geschwätz weiter zum nächsten Höhepunkt; kein Wunder, dass „;Rendezvous mit Rama“ auch im 21. Jahrhundert erstaunlich modern wirkt – ein zeitloser Klassiker seines Genres, der sich noch lange Zeit als solcher behaupten wird.
Kein Happy-End, sondern ein trauriger Epilog
„;Die Ramaner tun alles dreifach ...“ Mit diesen Worten endet „;Rendezvous mit Rama“; ein starker Schlusssatz, der nach Clarke keineswegs eine Fortsetzung ankündigte. In der Tat herrschte mehr als anderthalb Jahrzehnte Ruhe in Sachen „;Rama“. In dieser Zeit wurde der Schriftsteller von einer Nervenkrankheit befallen, die seinen baldigen Tod befürchten ließ. Mit „;The Fountains of Paradise“ (dt. „;Fahrstuhl zu den Sternen“) veröffentlichte er deshalb 1979 sein mutmaßlich letztes Werk.
Doch Clarke erlebte den Fortschritt, den er in seinen Geschichten so oft beschrieb, am eigenen Leib: Ein Heilmittel gegen seine Krankheit wurde gefunden, der Autor wieder gesund. Er setzte seine Karriere fort. Allerdings lässt sich eine deutliche Zäsur feststellen: Der ‚späte‘ Clarke schrieb nur noch selten selbst, sondern ließ schreiben, was angeblich so aussah, dass er Exposès lieferte, die von anderen Autoren umgesetzt wurden. Diese Heuerlinge konnten dem Altmeister selten das Wasser reichen. Auf jeden Fall trifft dies auf Gentry Lee (geb. 1942) zu, den sich Clarke als ‚Ko-Autor‘ wählte, als man ihn Ende der 1980er Jahre dazu überreden konnte, seinen Namen für eine lukrative Fortsetzung von „;Rendezvous mit Rama“ herzugeben.
In rascher Folge erschienen ab 1989 drei Romane, die immer seitenstärker und schlechter wurden, weil sie exakte jene Tugenden ignorierten, die den Ursprungsband kennzeichnen. Seifenoper und realitätsfernes Klischee-Abenteuer ersetzten das klare „;Rama“-Konzept, was indes nur die Kritiker zu stören schien: „;Rama“ II-IV waren sehr erfolgreich, weil gefälliger und für den SF-Mainstream zurechtgestutzt.
Rama 2 Rendezvous mit Übermorgen
„Die Ramaner machen alles dreifach...“
...war der letzte Satz in dem Klassiker „Rendezvous mit Rama“. Laut Arthur C. Clarke nur eine spontane Eingebung und kein Hinweis auf eine eventuelle Romantrilogie. 1989 war es dann doch soweit, mit dem Autoren Gentry Lee schrieb Clarke nun doch – entgegen früherer Dementi – eine Fortsetzung.
Eine zweite Chance
Das erste Anzeichen für außerirische Intelligenzen traf die Menschheit vollkommen unvorbereitet. Dadurch, dass der Kurs des plötzlich auftauchenden Schiffes das irdische Sonnensystem nur kurz streifte, blieb der Menschheit nicht viel Zeit eine Forschungsmission zu entsenden. Kurzerhand kontaktierte man also das am nächsten gelegene Schiff, welches eine Erforschung des fremden, auf den Namen 'Rama’ getauften Raumschiffes, vornahm. Doch nach dieser ersten Mission blieben viele Fragen offen. Woher kam das Schiff? Wer hatte es erbaut? Und welchem Ziel flog es entgegen?
Als siebzig Jahre nach der ersten Rama-Mission wieder ein fremdes Schiff auftaucht, werden sofort umfangreiche Vorkehrungen getroffen. Diesmal will die Menschheit die Gelegenheit nicht verpassen, hinter das Geheimnis von Rama zu kommen und vielleicht sogar Kontakt mit der Intelligenz herstellen, die diese Schiffe vor langer Zeit auf ihre einsame Reise geschickt hat. Ein Team bedeutender Experten wird zusammengestellt.
Während sich die zukünftigen Astronauten also auf diese wichtige Mission vorbereiten, müssen sie sich auf der Erde mit ganz anderen Problemen herumschlagen. Nach einer langen Krise hat sich die Weltwirtschaft gerade erst erholt, viele Weltraumprojekte wurden völlig eingestellt. Um eine Finanzierung der neuen Mission zu ermöglichen, ist – wie stets in der Raumfahrt – eine positive Öffentlichkeitsarbeit von Nöten. Prädestiniert für diese Aufgabe scheint das Ex-Model Francesca Sabatini, die als Reporterin mit an Bord sein soll. Immer auf der Suche nach einer Sensation, mit der sie ihr Publikum bei der Stange halten kann, durchwühlt Francesca die Vergangenheit der bunt zusammen gewürfelten Crew. Ihre eigenen dunklen Geheimnisse versteht sie dabei jedoch gut zu hüten.
Auch der exzentrische David Brown sorgt für einige Unruhe in der Gruppe. Nach seiner Meinung ist niemand anderes als er selbst dazu in der Lage, das Team anzuführen. Seine Gegenspieler dabei sind Richard Wakefield, das unumstrittene Genie unter den Astronauten und die Schiffsärztin Nicole de Jardins, die „Stimme der Vernunft“ in der bunten Riege von Exzentrikern und Eigenbrötlern.
Die schwere Bürde der Fortsetzung
Viele Hard-SF-Romane pflegen eine eher unterkühlte, steifmütterliche Behandlung ihrer Figuren. So auch in „Rendezvous mit Rama“, dem ersten Buch der Reihe. Während in Band Eins zukünftige Astronauten mehrere Ehefrauen hatten, die sogar voneinander wussten und friedlich koexistierten, machen es sich die Autoren bei den zwischenmenschlichen Beziehungen in diesem Buch nicht ganz so einfach. Im Gegenteil, in Rama-Zwei menschelt es gewaltig. Die ersten zweihundert Seiten erzählen lediglich von den Missionsvorbereitungen und beleuchten zahlreiche Aspekte der vielschichtigen Figuren.
Natürlich stellt sich die Frage, ob ein Buch wie „Rendezvous mit Rama“ überhaupt einer Fortsetzung bedarf. Am besten schneidet dieser zweite Band ab, wenn man ihn nicht als traditionelles Sequel betrachtet, sondern als einen alternativen Roman, eine Art „Rendezvous mit Rama B“. Das Buch baut nur wenig auf den Ereignissen des ersten Bandes auf, muss sich dem zweifelhaften Ruf, den Romanfortsetzungen meist genießen, also kaum stellen.
Für diesen Band wurde die im ersten Buch beschriebene Zukunft etwas überarbeitet. Man hat beinahe des Gefühl, die Autoren hätten die gesamte menschliche Geschichte seit dem erste Zusammentreffen mit „Rama“ konstruiert, bzw. umarrangiert, um die Bühne für das vorliegende Buch überhaupt erst zu schaffen. So ergeben sich durch die wieder konservativere Ausrichtung der Gesellschaft nach einer schweren Krise viele interessante philosophische Dilemma, wenn plötzlich die Existenz außerirdischen Lebens bewiesen wird. Jedoch meint man als Leser hierbei noch die unausgefüllten Fugen des literarischen Mosaiks ertasten zu können.
Ein Hauch von Hollywood
„Rendezvous mit Übermorgen“ ist ein durchaus eingeständiges Buch. Mit einem Hauch von Hollywood- Dramatik erzählen die Autoren die Schicksale der markanten Charaktere. Neben den vielschichtigen und interessanten Figuren, die sich so manchem Dilemma und skrupellosen, menschlichen Gegner stellen müssen, verfolgt der Leser auch noch die spannende Erforschung des fremden Schiffes.
Alles in allem ein guter SF-Roman, voller im Gedächtnis des Lesers haften bleibender Ideen. Auf „Die nächste Begegnung“ darf man gespannt sein.
Rama 3 Die nächste Begegnung
Verfasste Science-Fiction-Altmeister Arthur C. Clarke „Rendezvous mit Rama“ noch im Alleingang, musste er bei der anschließenden, weiterführenden Trilogie auf eine Zusammenarbeit mit dem Autor Gentry Lee zurückgreifen. Der gemeinsam verfasste Teil 2 des Rama-Zyklus endete mit einem Cliffhanger. Dementsprechend gespannt kann der Leser auf die Fortsetzung dieses Klassikers in deutscher Neuauflage sein.
Die Geschichte Ramas
Bereits im 22. Jahrhundert hatte eine Gruppe von Astronauten Kontakt mit einem extraterrestrischen Raumschiff. Das scheinbar per Autopilot gesteuerte Schiff gab jedoch seine Geheimnisse nicht preis. Unverrichteter Dinge mussten die Menschen aus Rama 1 flüchten, bevor das Schiff unser Sonnensystem wieder verließ.
Als viele Jahre später ein zweites Raumfahrzeug auftauchte, war die Menschheit besser vorbereitet. Diesmal konnten speziell für einen Erstkontakt trainierte Forscher Rama 2 erreichen. Unter den Astronauten waren auch Nicole de Jardins und Richard Wakefield. Gemeinsam mussten sie sich mit anderen Missionskollegen auseinandersetzen, die rein egoistische Gründe auf dieser wichtigen Mission verfolgten. Nachdem das geheimnisvolle Schiff plötzlich die Erde direkt ansteuerte, wurde seitens der Regierung ein atomarer Präventivschlag vorbereitet. Den Forschern blieb nicht viel Zeit, Rama 2 zu verlassen und so mussten vermisste Gruppenmitglieder ihrem Schicksal überlassen werden. Auf der Erde nimmt man seit der erfolgreichen Detonation an, dass Richard und Nicole sowie Michael O’Toole bei der Explosion umgekommen sind.
Doch die vermissten Forscher haben überlebt und auch das Schiff ist unbeschädigt geblieben. Als Rama 2 das Sonnensystem verlässt, befinden sich die drei Menschen an Bord. Unfähig in die Steuerung des Schiffes einzugreifen, können sie nur abwarten, wohin die Reise Ramas sie führen wird. Den Astronauten steht ein unglaubliches Abenteuer bevor, bei dem sie auch eine riesige Raumstation der Erbauer Ramas besuchen werden. Scheinbar sind die Fremden daran interessiert, mehr über alle intelligenten Spezies des Weltraums zu erfahren. Während die Menschen als Versuchskaninchen herhalten müssen, stellen sie sich immer wieder eine Frage: Was wollen die geheimnisvollen Erbauer Ramas wirklich?
Struktur und Schwerpunkte
Wichtigstes Merkmal dieses Buches ist seine Aufteilung in recht unterschiedliche Kapitel: Den Anfang macht ein fiktives Tagebuch Nicoles, das – logischerweise – aus der Ich-Perspektive die Geschehnisse während der Reise erzählt. Teil 2 widmet sich der Erforschung einer fremden Raumstation und wird nun in der gewohnten Erzählsicht geschildert. Weitere Kapitel erzählen von der Rückkehr zur Erde und einer Anwerbung geeigneter Probanden für die unbekannten Zwecke Ramas.
Wie schon in „Rendezvous mit Übermorgen“ liegt der Schwerpunkt dieses Buches eindeutig auf den zwischenmenschlichen Konflikten. Eine systematische, die zahlreichen Geheimnisse enthüllende Erforschung Ramas bleibt aus. Während ihrer Reise zu einem ungewissen Ziel bekommt Nicole mehrere Kinder unterschiedlicher Väter. Für den Leser wirkt die Entscheidung für eine Familie aufgrund der ungewissen Zukunft der Protagonisten teilweise etwas unglaubwürdig. Der langsam wachsende Wakefield-Clan spielt jedoch eine wichtige Rolle für den weiteren Verlauf der Handlung.
Lediglich der zum Ende des Buches führende Handlungsbogen will mit seinem Abschluß nicht recht überzeugen. Viele andere, besser ausgeklügelte Spannungsbögen basieren auf den erwähnten zwischenmenschlichen Konflikten. Diese deuten sich durch die Auswahl von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten schon an und spitzen sich im Lauf der Reise weiter zu. Eine eindeutige Stärke dieses Buches. Auf wissenschaftliche Plausibilität wird wenig Wert gelegt. Abenteuerliche Forschungsausflüge in die Weiten der fremden Raumfahrzeuge stellen die wenigen Science-Fiction-Elemente des Buches dar. Nicht jeder Science-Fiction-Leser fühlt sich bei diesen Schwerpunkten wirklich zuhause.
Mehrere unglaubwürdige Entscheidungen der Figuren mildern den Lesespaß etwas. Die weitergeführte Mystifizierung der Erbauer Ramas hält die Spannung jedoch weiterhin aufrecht. Die Story an sich ist außergewöhnlich und bietet eine Reihe unerwarteter Entwicklungen. Wer einen SF-Roman im besonderen über Menschen (in ungewöhnlichen Situationen) sucht, findet in diesem Buch eine interessante Alternative. Fazit: Kein herausragendes Highlight, jedoch gute SF-Unterhaltung.
Zeit-Odyssee 3 Wächter
In 'Die Zeit-Odyssee’ wurde die junge britische Soldatin Bisesa Dutt samt ihres Helikopters und ihrem Co-Piloten in eine fremde Welt katapultiert. Stück für Stück fanden sie und ihr Mitstreiter heraus, dass diese Erde eine Patchwork-Welt, zusammengesetzt aus allen Epochen der Menschheitsgeschichte, war. Begleitet wurden sie dabei von den mysteriösen Augen, welche die Menschen scheinbar beobachteten. Letztlich konnte Bisesa herausfinden, dass sie dies alles geheimnisvollen Außerirdischen verdankten.
Nachdem sie wieder in ihr eigenes Universum zurückfinden konnte, musste sich Bisesa einer der größten Katastrophen in der Geschichte der Menschheit stellen. Ein Sonnensturm drohte alles Leben auf der Erde zu vernichten. Nur knapp, und mit vereinten Kräften, konnte die Menschheit diese Krise überstehen. Die Außerirdischen, die sich die Erstgeborenen nennen, hatten zugeschlagen.
Neunzehn Jahre nach dem Sonnensturm erwacht Bisesa Dutt in einem Stasetank. Ihre Tochter, die mit 41 Jahren nun beinahe so alt ist wie ihre Mutter, hat sie aufwecken lassen. Bisesa scheint die einzige Hoffnung im Kampf gegen einen neuen Angriff der Erstgeborenen zu sein. Eine Q-Bombe rast nämlich auf die Erde zu. Verzweifelt versuchen die Menschen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, die fremde Technologie zu verstehen und aufzuhalten, scheitern aber ein ums andere Mal. Indes flieht Bisesa mit ihrer Tochter zu den im Weltraum lebenden Spacern.
Zeitgleich hat sich auf Mir, der nun seit 31 Jahren in einem Taschenuniversum existierenden Patchwork-Erde, eine neue Gesellschaft entwickelt. Menschen aus unterschiedlichen Epochen wachsen langsam zusammen, entwickeln sich dabei jedoch nicht nur zum Besseren. Doch auch die Tage von Mir scheinen gezählt zu sein.
Das Werk zweier SF-Koriphäen
Den Hauptteil des Romans macht die Reise Bisesa Dutts aus. Nebenlinien bilden die Erlebnisse ihrer Tochter und die Abwehrmaßnahmen der Erdregierung, in Person von Bella Fingal. Tatsächlich sind alle Hauptcharaktere Frauen. Die gesamte Geschichte verläuft sehr gradlinig und befasst sich thematisch beinahe nur mit dem Kampf gegen die drohende Auslöschung der Erde.
Eine Zusammenarbeit zwischen Stephen Baxter und Arthur C. Clarke scheint auf den ersten Blick eine runde Sache zu sein. Ihre Stile sind sich sehr ähnlich. In vielen Romanen Clarkes sind Außerirdische auf Menschen sehr fremd wirkende, ferne Schattengestalten, deren Motive immer etwas im unklaren bleiben. Auch in 'Wächter’ tauchen die Erstgeborenen nie als handelnde Personen auf, bleiben immer im Hintergrund. Dadurch lässt der Roman zwangsläufig noch einige Fragen offen. Von Stephen Baxter kennt man – neben einem gewohnt routinierten Stil – eine interessante Charakterzeichnung und feinsinnige Charakterbeobachtungen. Indem die Autoren moderne Begriffe wie „Blog“, „Avatare“ und „Datennetzwerke“ verwenden, wirkt der Roman nicht so altbacken wie manch anderes Werk alternder SF-Größen.
Wächter ist der dritte Roman, der durch die Zusammenarbeit Clarkes und Baxters entstand und knüpft in seiner Handlung an 'Sonnensturm’ an. Vorkenntnisse sind also durchaus vonnöten bzw. machen vieles für den Leser überhaupt erst interessant.
Schon seit Jahren arbeitete der schwer kranke Clarke mit wechselnden Co-Autoren zusammen. 'Wächter’ war sein letztes Werk vor seinem Tod im März 2008.
Reisebericht vs. Handlung
Mit diesem Buch wird dem Leser – angelehnt an Clarkes bekanntestes Werk 'Odyssee im Weltraum’ – eine neue Odyssee versprochen. Leider haben es die Autoren mit diesem Begriff etwas zu genau genommen. Man wird mit einer nicht enden wollenden Reiselust von Bisesa Dutt konfrontiert. So lernt der Leser zwar Stück für Stück die Welt in der Mitte des 21. Jahrhunderts kennen, doch wirkliche Handlung, Entwicklung in der Geschichte, findet nicht statt. Beinahe zwei Drittel des Buches brauchen die Autoren, bis die Geschichte endlich etwas an Fahrt aufnimmt. Dann wird es etwas spannender, ebbt nach einem verfrühten Spannungshöhepunkt jedoch schnell wieder ab.
Vieles in diesem Roman wirkt bruchstückhaft, die kurzen Kapitel über Nebenschauplätze sind da nicht das Einzige. Das Ende ist wiederum sehr melancholisch. Die Stimmung in diesem Buchabschnitt ist gut eingefangen.
Eine der größten Stärken Baxters, das Sich-hinein-versetzen in vollkommen fremde Lebewesen, kann in 'Wächter’ überhaupt nicht zur Geltung kommen. Die Geschichte an sich bleibt zu lange uninteressant, die Charaktere roboterhaft-blass. Nach zwei guten Büchern ist 'Wächter’ ein enttäuschender Abschluss der neuen Odyssee-Trilogie und als letzter Roman Clarkes zum Glück nicht repräsentativ für das Werk dieses großen SF-Autoren.