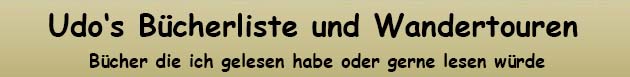Beckett, Simon-Rezension
David Hunter 1 Die Chemie des Todes
Einst war er einer der führenden forensischen Mediziner Englands: David Hunter hat sie alle übertroffen, wenn es galt einem modernden Mordkadaver die Geheimnisse seines Todes zu entlocken. Dann kam seine Familie durch einen Unfall um, was Hunter beruflich und privat aus dem Gleis warf. Er floh aus der Großstadt und ließ sich als einfacher Landarzt in dem kleinen Dorf Manham in der englischen Grafschaft Norfolk nieder.
Die Tage des selbst gewählten Exils neigen sich dem Ende zu, als in einem Wäldchen die übel zugerichtete Leiche von Sally Palmer gefunden wird – traktiert mit scharfen Messern und mit Schwanenflügeln dort, wo eigentlich nur Schulterblätter sein sollten. Chief Inspector Mackenzie findet wenige Spuren aber David Hunter, der ihn bei seinen Ermittlungen unterstützen soll. Als dieser sich weigert, traktiert ihn der mürrische Polizist so lange, bis Hunter nachgibt.
Den Ausschlag dafür gibt das Verschwinden von Lyn Metcalf. Nicht nur Mackenzie fürchtet, dass der unbekannte Mörder die junge Frau in seine Gewalt gebracht hat. Ein Wettlauf auf Leben und Tod beginnt. Die Suche im dichten Wald um Manham ist gefährlich, denn der Kidnapper hat überall Schlingen aus- und Fallgruben angelegt, die für zahlreiche Verletzungen sorgen. Im Dorf selbst schwingt sich der fanatische Law-and-Order-Pfarrer Scarsdale zum Sprecher der Furchtsamen und Misstrauischen auf. Eine Bürgerwehr wird aufgestellt, die mehr Schaden anrichtet als zu schützen. Die Lage spitzt sich zu, als weitere Leichen gefunden werden.
Für Dorffremde und Außenseiter wird das Leben in Manham ungemütlich, denn die braven Bürger suchen Sündenböcke. Alte Rechnungen werden bei dieser günstigen Gelegenheit gleich mit beglichen. Auch Hunter kommt ins Gerede, hält aber tapfer aus: Der Mörder hat sich ausgerechnet seine neue Freundin geschnappt, der das bekannte Ende droht, wenn es nicht endlich gelingt die kärglichen Beweise so ordnen, dass dem Täter Einhalt geboten werden kann …
Ein Roman als Opfer übertriebener Werbung?
Die Chemie des Todes ist als Roman längst nicht so interessant wie der Konflikt, der sich in der Kritik entzündet hat. Der nüchterne Tatbestand ist für den erfahrenen Krimileser rasch klar: Dies ist ein solider Thriller um bizarre Serienmorde und unterhaltsam dargebotene Ermittlungstechniken, der – verschnitten mit dem üblichen Quantum Seifenoper – dem Genre weder nützt noch schadet. Ruhig und bei langsamem Aufbau der Spannung erzählt Autor Beckett eine Story, wie sie die Liebhaber »klassischer« britischer Krimis normalerweise lieben und die in jedem Jahr zu Dutzenden – meist als Taschenbuch mit gesichtslosem Bildstock-Einheitscover- auf den Buchmarkt geworfen werden.
Den Unterschied macht offensichtlich das Getöse der Werbetrommel, die für Die Chemie des Todes gerührt wurden. »Die Wiedergeburt des Thrillers«, so beispielsweise ein deutscher Fanfarenstoß, war anscheinend der eine Tropfen Eigenlob, der das Fass des Verdrusses überlaufen ließ. Der Ton wird in der Werbung bekanntlich schärfer, die Konkurrenz ist groß. Längst sind bei den Verlagen sämtliche Hemmungen gefallen, noch der übelste Mist wird nicht nur gedruckt sondern auch in Superlativen angepriesen. Man fällt als Leser womöglich darauf herein und ist verstimmt. Trotzdem ist es ungerecht, dass ausgerechnet der arme Simon Beckett die Zeche zahlen soll.
Ein Krimi mit Tadel aber auch mit Meriten
Zur Klage gibt es selbstverständlich Anlass. Wieso wählt der Autor als Hauptfigur einen Forensiker, wenn er für die Handlung recht wenig Kapital dafür schlägt? Oder sind wir alle bereits so CSI- & Scarpetta-geschädigt, dass wir ohne Seziersaalbabbel und labortechnischen Overkill etwas vermissen? Beckett lässt Hunters Beruf nämlich sehr wohl in die Handlung einfließen – angenehm zurückhaltend allerdings und primär dort, wo seine Erkenntnisse zur Geschichte beitragen, wie der Verfasser entschied sie zu erzählen.
Dazu gehört auch der gemächliche Einstieg ins kriminalistische Geschehen. Die Chemie des Todes ist einerseits kein Actionthriller und andererseits Auftakt zu einer Serie mit David-Hunter-Romanen. So nimmt sich Beckett die Zeit diese Figur und ihre von tiefen inneren Konflikten geprägte Geschichte sorgfältig aufzubauen bzw. zu erzählen, während sich der kriminalistische Handlungsstrang erst nach und nach in den Vordergrund schiebt. Selbstverständlich gehört die vorsichtige Annäherung ans weibliche Geschlecht zu Hunters Gesundungsprozess und natürlich ist es das Objekt seiner neu erwachten Begierde, das dem Mörder in die Finger gerät: Die Chemie des Todes ist halt ein konventionell geplotteter Thriller. Wer sich ohne große Vorab-Erwartungen an die Lektüre begibt sowie die Dreistwerbung als auch die aus Verärgerung geborene Negativkritik ignoriert, wird durchaus seinen Lesespaß finden und sich über den Sturm im Reagenzglas wundern, den dieser Allerweltskrimi auslöste.
David Hunter trägt zwar einen »sprechenden« Namen, benimmt sich jedoch ganz und gar nicht wie ein Jäger. Beckett schildert ihn als gebrochenen Mann, der nach einer persönlichen Tragödie aus seinem psychisch anstrengenden Job als Gerichtsmediziner »aussteigt« und in der Stille der Provinz einen Neuanfang versucht. Die damit verbundenen Schwierigkeiten schildert der Verfasser überzeugend aber ohne das Seelendrama neu zu erfinden.
Der Versuch leiser Töne
Hunter ist kein Sherlock Holmes des 21. Jahrhunderts, der sich eifrig über faulige Leichen beugt, um sie unter Präsentation angenehm ekliger Überraschungen zu »lesen«, sondern ein verstörter und störrischer Zeitgenosse, der sich zudem gegen die Rolle des zentralen Handlungsträgers sträubt. Tatsächlich wehrt er sich gegen alles, das den mühsam geschaffenen Panzer aus Routine und Gleichgültigkeit zerbrechen könnte. Eine blitzartige Wiedergeburt als spürgewaltiger Schnüffelforensiker wäre deshalb reichlich unglaubwürdig.
Beckett mag kein Neuerer sein aber er bemüht sich wenigstens, allzu ausgefahrene Geleise zu vermeiden. Sein Manham ist kein Sammelbecken ulkiger Dorftypen oder -trottel, die in so vielen – zu vielen – »Whodunits« den Hintergrundchor abgeben müssen. Das Verderben kommt über eine Gemeinde, der Harmonie stets ein Fremdwort war. In der Krise bildet sich keine Gemeinschaft; stattdessen bilden sich Gruppen, die einander argwöhnisch belauern und höchstens in ihrer Hatz auf verdächtige Außenseiter einig sind: Selbst die Bürger von Manham unterliegen im 21. Jahrhundert dem alten Irrglauben, dass auf dem Land Frieden dort herrscht, wo in der Stadt das Böse regiert.
Pfarrer Scarsdale ist das Sprachrohr für die gleichzeitig Ängstlichen und Aggressiven – leider ein reichlich verbeultes, so heißen: Scarsdale ist Beckett zum Zerrbild missglückt. Er wirkt wie ein frühneuzeitlicher Hexenjäger, der im Namen des HERRN seinen persönlichen religiösen Fundamentalismus nährt. Selbst in der Provinz dürfte es indes kaum mehr möglich sein »normale« Menschen auf diese Weise in einen hysterischen Lynchmob zu verwandeln. Beckett merkt es selbst und lässt diesen Handlungsstrang unauffällig versanden.
Der Mörder muss einer der Manham-Bewohner sein – so verlangt es die Regel. Wer es sein könnte, dämmert dem Leser eventuell ein wenig zu früh; Beckett verteilt in dieser Hinsicht großzügig Hiebe mit dem Zaunpfahl. Ansonsten hält sich der Verfasser auch hier an die Konventionen, die einen Irrsinnigen fordern, der rasch und gnadenlos killt und erst im Finale vom Drang erfasst wird, sich dem Helden in einem wahren Redeschwall zu offenbaren. Kein Wunder, dass es so mit dem perfekten Mord nichts wird …Auch hier gilt freilich: Beckett mutet seinem Publikum auch nichts Schlimmeres zu, als es gewöhnt ist.
David Hunter 2 Kalte Asche
Dr. Simon Hunter, forensischer Anthropologe der Universität London, freut sich nach einer anstrengenden Dienstreise auf die Heimreise, als ihn ein Hilfegesuch der Polizei nach Runa, eine kleine Insel der Äußeren Hebriden vor der Nordwestküste Schottlands, führt. Dort wurde in einem verfallenen Cottage eine völlig verbrannte Leiche entdeckt, die Hunter nicht nur untersuchen, sondern auch feststellen soll, ob ein Mord oder nur ein Unfall vorliegt.
Runa ist eine dieser kleinen aber fest in sich ruhenden Inselgemeinschaften, deren Mitglieder sich sämtlich zu kennen glauben. Konflikte werden intern gelöst, und »denen vom Festland« steht man geschlossen misstrauisch und ablehnend gegenüber. Das erschwert die Ermittlungen, zumal Hunter mit Sergeant Fraser ein schroffer und dem Alkohol ergebener Polizeibeamter zur Seite gestellt wurde.
Die Leiche entpuppt sich als weiblich – und der Schädel weist deutliche Spuren eines heftigen Schlages auf. Der Tod war folglich gewaltsam – und der Täter oder die Täterin muss sich noch auf der Insel aufhalten, die in den Wochen seit dem Mord nachweislich niemand verlassen hat.
Während Fraser sich dem Fall zunehmend als nicht gewachsen erweist, kann sich Hunter auf die Unterstützung des ehemaligen Inspektors Andrew Brody verlassen, der nach einer privaten Tragödie seinen Altersruhesitz auf Runa genommen hat. Der alte Polizist hat seinen Job nicht verlernt. Gemeinsam mit Hunter nimmt er die Schar der Verdächtigen unter die Lupe. Die ist zwar klein aber schwer zu durchschauen. Dass Runa diverse Geheimnisse birgt, wird sogar dem »Fremdling« Hunter rasch klar.
Die Atmosphäre ist gereizt, die Ermittler sind nicht willkommen. Dann bricht ein gewaltiger Sturm los, der Runa völlig isoliert – und dem Mörder die willkommene Gelegenheit bietet, Spuren zu verwischen und mögliche Zeugen zu beseitigen, zu denen sich zu seinem Schrecken und Nachteil auch David Hunter zählen muss …
Kleine Insel mit hohem Bodycount
Hoch schlugen die Wellen, als Simon Beckett 2006 seinen ersten Krimi um den psychisch angeschlagenen Forensiker David Hunter veröffentlichte. Allzu drastisch beschreibe er, was der Tod mit dem menschlichen Körper anrichte, während der eigentliche Romanplot zu dürftig daherkomme, so der grundsätzliche Tenor der Kritik, von der sich die Leser indes nicht beeindrucken ließen. Ihnen gefiel Die Chemie des Todes als Buch, das bei objektiver Betrachtung weder besser noch schlechter als die meisten zeitgenössischen Thriller war.
Kalte Asche ist das zweite Kapitel in der David-Hunter-Vita, das Beckett wieder als Kriminalgeschichte erzählt. Gegenüber dem Debüt gibt es diverse Veränderungen bzw. Entwicklungen. Dieses Mal steht die Ermittlung im Vordergrund, während Hunters private Probleme (angenehm) ausgeklammert oder nur kurz angerissen werden. Kalte Asche ist ein klassischer Whodunit, der geschickt mit den literarischen Stilmitteln des 21. Jahrhunderts dargeboten wird.
Der Mord auf einer durch das Meer und das Wetter isolierten Insel ist wahrlich kein Einfall, der durch Originalität besticht. Wer Krimis liest, wird sogleich ältere Romane nennen können, die sich dieser Kulisse bedienen. (Der bekannteste ist vermutlich Ten Little Niggers / And Then There Were None, 1939; dt. Zehn kleine Negerlein / Letztes Weekend / Und dann gabs keines mehr von Agatha Christie.) Die Vorteile liegen auf der Hand: Der Schauplatz ist (scheinbar) überschaubar, die Zahl der Verdächtigen bleibt auf die (kleine) Gruppe der Insulaner beschränkt. Ein guter Autor wird sich hüten unfair vorzugehen, was bedeutet, dass Leser, die miträtseln möchten, über dieselben Indizien und Hinweise verfügen wie die ermittelnden Beamten und Detektive.
Was natürlich eine Illusion ist, was wir durchaus wissen. Letztlich erwarten wir, dass uns der Verfasser im großen Finale überrascht und die sorgfältig gelegten Spuren ad absurdum führt. Dieser Erwartung wird Beckett völlig gerecht, bevor er leider dem heutzutage üblichen Hang zum »Last-Minute-Twist« folgt, d. h. auf den letzten Seiten den eigentlichen Übeltäter ans Licht zerrt, um der bisher erzählten und logisch aufgeklärten Story eine gänzliche neue Deutung aufzupfropfen.
Selbst das übersteht diese Geschichte gut, aber Beckett will den Jefferey-Deaver-Effekt und zieht auf der allerletzten Seite noch ein As aus dem Ärmel – er versucht es jedenfalls, denn was hier stattfindet, ist ebenso lächerlich wie billig und verdirbt viel von dem gutem Eindruck, den Kalte Asche bisher hinterließ.
Eine/r muss es gewesen sein
Denn Runa ist ein malerischer und überzeugender Ort für diesen ziemlich abenteuerlich geplotteten Thriller. Einsame Hügel, bestanden mit steinzeitlichen Hügelgräbern, dazwischen Moore, darüber Nebel, Wolken und Regen – hier ist die Zivilisation sichtlich abwesend, verläuft das Leben nach alten, sogar archaischen Regeln. Die Inselgemeinde ist eine verschworene Gemeinschaft, in der Konflikte freilich gären wie in einem Dampfkochtopf. Nicht selten entweicht der Überdruck explosiv = gewalttätig und straft den Anschein eines gemütlich-trägen Inselalltags Lügen.
Einig ist man allerdings im Schulterschluss gegen alle »Fremden«. Das schließt sogar den Wohltäter Michael Strachan ein, dem man es insgeheim verübelt, dass er über die finanziellen Mittel verfügt, seinem Gutmenschentum zu frönen. Gern würden die Insulaner ohne solche Hilfe auskommen, die sie eher gnädig als freudig oder gar dankbar annehmen.
Sergeant Fraser verkörpert perfekt das ungeliebte »Festland«, dessen Vertreter ohne Rücksicht auf die feinen Strukturen der Runa-Gesellschaft umherpoltern und gern Überlegenheit bzw. Überheblichkeit an den Tag legen. David Hunter versucht es mit »Verständnis«, trägt aber dabei ebenfalls zu dick auf und stößt auf Ablehnung. Wie Fraser begreift Hunter nicht, dass Runa für seine Bewohner gleichermaßen Segen und Fluch ist – kein idyllischer Urlaubsort, sondern harte Realität und ebenso Heimat wie Verbannung.
Knochenlese als Kreuzzug gegen das Vergessen
David Hunter wird durch die Ereignisse auf Runa immerhin erfolgreich von seiner nach wie vor schwierigen privaten Situation abgelenkt. Nur halbwegs hat er den tragischen Verlust von Frau und Kind überwunden. Seine neue Gefährtin ist nach schrecklichen Erlebnissen (s. Die Chemie des Todes) selbst mental labil. Die Beziehung ist ohnehin schwierig, und die Spannungen verschärfen sich, weil Hunter von seiner – durchaus obsessiven – Beschäftigung mit meist grausam zu Tode gekommenen Menschen nicht lassen will. Er hat darin seinen Ausgleich gefunden, der ihm hilft, den Verlust der Familie zu kompensieren: Hunter will Antworten auf Fragen, die ohne seinen Einsatz womöglich unbeantwortet blieben.
Im Vergleich zu Die Chemie des Todes räumt Beckett dem inneren Ringen Hunters deutlich weniger Raum ein. Dem Roman kommt das sehr zu Gute, da der Verfasser die eigentliche Handlung vorantreibt. Er hält das Tempo durch, verzettelt sich nicht mehr in den endlosen Selbstzerfleischungen, die Hunters Denken und Handeln im Vorgängerband allzu stark bestimmen. Auch in dieser Hinsicht wirkt Runa katalytisch: Die Insel ist auch für Hunter eine Stätte jenseits seines Alltagslebens, mit dem er sich während seines Aufenthaltes nur sporadisch beschäftigen muss.
Ob Hunter dank des angemerkten (aber hier natürlich verschwiegenen) finalen Knalleffekts noch einmal ermitteln wird, ist unklar – soll unklar wirken, aber im Grunde lässt sich niemand vom Verfasser in die Irre führen. Stattdessen legt Beckett das Fundament für neue private Turbulenzen seines Helden, der mit ziemlicher Sicherheit recht bald seine nächste garstige Leiche unter die Lupe nehmen wird.
David Hunter 3 Leichenblässe
Was CSI in der Folge Burden of Proof (»Die Last der Beweise«) recht war, ist Simon Becketts Leichenblässe billig. Er lässt Teile des Romans auf der Body Farm in Knoxville spielen, jenem Freiluftgelände, das zur Universität von Tennessee gehört, und auf dem der Zerfall menschlicher Leichen akribisch studiert wird. Dorthin verschlägt es den forensischen Anthropologen David Hunter auf Einladung seines Freundes und Mentors Tom Lieberman. Eine schwere Verletzung auskurierend, hadert Hunter mit sich selbst, seiner Aufgabe und der Welt, während er durch’s Unterholz kriecht und verwesende Leichen untersucht. Doch es bleibt nicht lange beschaulich. In einer Waldhütte wird der übel zugerichtete Körper eines Mannes gefunden. Lieberman wird mit der Autopsie beauftragt. Hunter darf ihm assistieren und wird alsbald in einen Fall hineingezogen, der zu einem Serienkiller führt, der seine Faszination für den Zeitpunkt des Übergangs vom Leben in den Tod mit Macht und Gewalt auslebt.
Leichenblässe ist der dritte Roman mit dem forensischen Anthropologen David Hunter in zentraler Rolle und stürmte die Bestsellerlisten in Windeseile. Stellt sich brennend die Frage: wieso?
Gut, Simon Beckett kann flüssig schreiben, sein Roman ist ohne Anstrengung leicht lesbar und leidlich spannend. Seine Beschreibungen von zerfallenden, verwesenden Leichen sind ausführlich, detailliert und vermutlich faktisch fundiert. Genau damit werden die ersten hundert Seiten raumfüllend über die Runden gebracht, wenn man vom Gejammer des traumatisierten David Hunter absieht, der sich alle naselang in düsteren Gedanken darüber ergeht, wie sein Blut auf den Boden tröpfelte, während ein Messer tief ins einen Eingeweiden steckte. So hadert er mit sich selbst und seinem Job. Aber nicht ernsthaft, denn natürlich wird der Forensiker bis zum bitteren Ende bei der Stange bleiben.
Wer jetzt glaubt, in seinem Denken würde sich irgendwas verändern, der irrt. Hunter stolpert – ebenso wie sämtliche Nebenfiguren – wie an einem unsichtbaren Draht gezogen, durch die kaum vorhandene Handlung. Fast alles in Leichenblässe ist zusammengeklaut und in einen halbwegs sitzenden Anzug gepresst worden. Wenn man sich nicht gerade in eine mäßige CSI Folge hineinversetzt sieht, wird man zurückgeschleudert in der Zeit; die Motivation des Mörders entspricht der »Peeping Toms« (Augen der Angst), der Hauptfigur jenes skandalträchtigen Thrillers aus dem Jahr 1960, der sowohl Regisseur Michael Powell wie Hauptdarsteller Karlheinz Böhm die Karriere kostete. Von den unzähligen filmischen und literarischen Varianten abgesehen, die im Lauf der letzten vierzig Jahre folgten. Darüber hinaus hat Leichenblässe nichts mitzuteilen, was nicht in einschlägigen Sendeformaten schon x-mal über die Bildschirme flimmerte. Doku-Soaps, die scheinbar wissenschaftlich, aber im Grunde mehr spekulativ als spektakulär, knietief im Gedärm, auf den Spuren der Toten wandeln. Warum nicht gleich zu einem Anatomie-Handbuch greifen, oder eine der seriöseren Dokumentationen über die Body-Farm anschauen?
Die Abwesenheit einer überzeugenden Geschichte wäre vielleicht zu verschmerzen, wenn die Charakterzeichnungen tief und sinnig wären. Doch auch hier bleibt der Roman seltsam blass.
Stattdessen bietet er jede Menge flache Abziehbilder, die wir alle zur Genüge kennen. Die toughe Bundesagentin, die mehr als eine Eigenschaft mit Jodie Foster teilt; der brummige Sektionsleiter mit dem Herz am rechten Fleck; der arrogante Profiler und sein nicht weniger unangenehmer Kollege aus der Pathologie. Ein Friedhofsbesitzer, der an ähnliche Vertreter aus schwarzhumorigen Gruselkomödien der 60er erinnert, ist in diesem Reigen platter Physiognomien fast schon sympathisch. Dass die Pathologie-Assistentin Summer offenkundig ein blondiertes Abbild Abigail »Abby« Sciutos aus der Fernsehserie Navy CIS ist, stellt eher eine dreiste Kopie als eine freundliche Hommage dar. Tiefergehende Schlüsse lässt das Buch nicht zu, denn dazu sind ihre Auftritte zu kurz. Wie die restlichen Akteure ebenfalls an der kurzen Leine gehalten werden. Bis auf David Hunter, dessen selbstmitleidige Jammertour im ersten Drittel zunehmend auf die Nerven geht. Bevor sie im weiteren Verlauf des kruden Geschehens kaum noch eine Rolle spielt. Nur ganz selten hält Beckett inne und gönnt dem Leser einen erweiterten Blick auf seine Knallchargen. Nur, um auf die offensichtlichen Klischees weitere draufzusetzen. So hockt der cholerische Pathologe Hicks einsam in seinem Büro, mit sich und der Welt im unreinen, und wie pflegt er sich dabei zu beschäftigen: genau, er gießt sich einen hinter die Binde. Welche Tiefenschärfe, welche Betroffenheitsattitüde, mehr sitzt nicht drin und auch das nur für einen Absatz, dann entschwindet Hicks im Vergessen.
Wie Beckett ohnehin liederlich mit seinen Kleindarstellern umgeht. Auf meuchelmörderische Art erwischt es im Verlauf des Buches fast nur unsympathische, arrogante oder zumindest unangepasste Zeitgenossen. Wer lieb und nett ist, darf zumindest hoffen. Über die restlichen Opfer des blässlichen Killers erfährt man sowieso kaum etwas. Der Höhepunkt der Perfidie ist erreicht, als Hunter und sein Kollege Paul auf der Suche nach einem Entführungsopfer, auf eine übelst zugerichtete Leiche stoßen. Beide verzweifeln kurz, bis Hunter Entwarnung gibt, und sie beinahe ein Freudentänzchen aufführen – die Tote ist, zumindest vorerst, nicht das gesuchte Kidnappingopfer. So tändelt der Roman zwischen Kaltschnäuzigkeit und Katzenjammer. In Becketts Welt gibt es nichts zu erfahren über das Leben und den Tod, außer das Witterung und Insekten Einfluss haben auf den Verwesungsprozess. Alles an Leichenblässe ist pure Oberfläche. Ein Patchwork mit groben Nähten, das dem Stillstand nicht anheimfällt, weil sich die Protagonisten gelegentlich von einem Handlungsort zum nächsten bewegen.
Oder sollte es sich bei den Abenteuern des David Hunter etwa um Parodien handeln? Die Banalität des Bösen als schwarzhumoriger Ausflug ins Moderbecken? Vielleicht verkündet Beckett, quasi als männliche Rosamunde Pilcher des Morbiden, den Sieg der hohlen Männer in einem toten Land. Dann könnten seine Bücher als derbe Kommentare zum verrotteten Zustand der Welt gelesen werden. Dazu fehlt nur noch ein Chor durchtriebener Psychokiller, der den unsterblichen Monty-Python-Klassiker Always look on the bright Side of Life anstimmt und ihn mit einem fröhlichen »You know, you come from nothing – you’re going back to nothing. What have you lost? Nothing!« zum Ende bringt. Wenn wir uns schon in einer oberflächlichen Werbewelt befinden, die die Verderblichkeit mittelfristig haltbarer Waren feiert, ist nichts unmöglich. Aber fraglich.
Vorteilhaft immerhin, dass der Roman viele Details aus dem Vorgänger preisgibt, sodass man guten Gewissens darauf verzichten kann diesen zu lesen. Für die gesparte Zeit darf man dankbar sein.
David Hunter 4 Verwesung
Nachdem David Hunter in Leichenblässe sein Mordgeschehen von London auf die Body Farm nach Knoxville, Tennesse, verlagert hatte, um uns mit Exhumierungen von Leichen, thantophilen Mördern, Larven von Sumpflibellen zu schockieren, erfahren wir zu Anfang von Verwesung mehr über den Verlust seiner Frau Kara und seiner Tochter Alice.
Beckett verlässt sich auf das, was Die Chemie des Todes neben der schockierenden Beschreibung von Leichen ausgezeichnet hat: auf das Psychogramm eines von einem Schicksalsschlag gezeichneten Forensikers, der sich selbst zu entfliehen versucht, weil er glaubt, am Tod seiner Familie Schuld zu sein.
Aus Eifersucht hat er vor acht Jahren eine Ausrede erfunden, um seine Tochter nicht abholen zu müssen. An seiner Stelle kam seine Frau Kara und wurde auf dem Heimweg in einen todbringenden Unfall verstrickt. Seitdem plagt sich Hunter mit der Frage herum: Was wäre gewesen, wenn er statt Kara Alice abgeholt hätte? Wäre der Unfall dann auch geschehen?
Gegenstand seiner Eifersucht war damals Terry Connors. Ein DI, der im Verlauf von Verwesung noch eine entscheidende Rolle spielen wird. Der Mann trinkt, spielt sich als Frauenheld auf und war bis zu jenem schicksalhaften Tag vor acht Jahren, mit Hunters Familie befreundet. Ausgerechnet Connors fühlte sich zu einem alkoholisierten Mobbing zu Kara hingerissen, während Hunter mit dem Entsetzen der Massengräber in Bosnien zu kämpfen hatte. Bei Hunters Rückkehr ist Kara auf Grund von Terrys ungehobelten Verhalten verstört, was ihren Mann umtreibt, bis es zum verhängnisvollen Unfall kommt.
Simon Becketts Romanserie um David Hunter heftet man allzu gern das Etikett düster an. Er wird für ihren detailverliebten Schrecken gelobt. Den Suspense bezieht der Autor vor allem daraus, dass David Hunter in auswegslose Situationen gerät, die er nie unbeschadet übersteht. In Kalte Asche wird gar auf ihn eingestochen werden und die Täterin spurlos verschwinden.
In Verwesung verlässt sich der Autor leider mehr auf das schaurige Ambiente eines sumpfigen Moors, der klaustrophobischen Angst unterirdischer Gänge und rührenden Szenen in verlassenen Minen, in denen Todgeweihte, festgeklemmt in einer Bergspalte im letzten Moment gerettet werden.
Das eigentliche Verbrechen um das Hunters Vergangenheit gestrickt ist, dreht sich um Jerome Monk, einem Serienmörder und Vergewaltiger, der die Morde an drei jungen Mädchen gestanden hat. Das erste Mal trifft Hunter ihn, als er gebeten wird, sich an der Identifizierung der Leiche von Tina Williams in Dartmoor zu beteiligen. Monk bietet sich an, bei der Suche zu helfen, weil er sich angeblich nicht mehr erinnert kann, insgeheim jedoch die Gelegenheit zu einem Fluchtversuch zu nutzen plant. Dies alles geschieht acht Jahre vor Monks Ausbruch aus dem Gefängnis.
Wie immer herrschen bei Beckett Uneinigkeit und Arroganz im Ermittlungsteam. War es in Leichenblässe der Professor und Profiler Irving, der für seine Arroganz abgestraft wurde, ist in Verwesung Leonard Wainwright gleichfalls Professor und forensischer Archäologe, derjenige der nicht nur Hunters Erkenntnisse als seine ausgibt, sich auch höhnisch über Monk auslässt. Auch er wird abgestraft werden.
Jerome Monk wird zum Knotenpunkt all jener, deren Schicksal viele Jahre später erneut zusammen geführt werden. Auch das von Sophie Keller, einer Beraterin, die anhand von psychologischen Erkenntnissen eines Täters, Strategien für Verhöre erstellt und mögliche Grabstellen mittels Orientierungspunkten in der Landschaft ausfindig macht.
Dass bei genauem Lesen, sich der eigentliche Schuldige wegen seiner Überzeichnung ziemlich schnell zu erkennen gibt, fängt Beckett durch glänzend formulierte Momente auf, die Menschen in ihrem persönlichen Abgleiten zeigen. Selbst seine Antihelden wie Wainwright oder Terry Conners versprühen dabei eher die Hilflosigkeit eigener Schwächen, als dass sie mutwillig agieren.
Wenn Beckett seine Figuren auf diesem Weg folgt, ergibt sich ein faszinierendes Tableau von Ermittlern, Verdächtigen und einem Mörder, die alle auf ihre Weise nur eines tun: Im Wasser um sich schlagen, um bloß nicht unterzugehen.
Vielleicht Becketts ehrgeizigster Thriller, weil er beinah ganz auf das wohldosierte Abseitige und den krassen Schrecken verzichtet, um seine Figuren in einem unausweichlichen Netz zu verspinnen.
Obsession
Nach den sensationellen Erfolgen von Die Chemie des Todes und Kalte Asche musste es ja zwangsläufig so kommen. Eifrig suchte der Verlag nach weiteren Werken des Autors und so wurde im April 2009 Obsession neu auf den deutschen Buchmarkt geworfen, nachdem der Roman schon damals, es war 1998, floppte. Doch anders als ein guter Wein reift ein schwaches Buch eben nicht im Lauf der Jahre und so ist zumindest eine kleine Warnung mehr als angebracht.
Sarah stirbt nach zweijähriger Ehe völlig unerwartet an einem Aneurysma, einer geplatzten Ader in ihrem Kopf. Somit steht Ehemann Ben Murray von heute auf morgen mit seinem autistischen Stiefsohn Jacob alleine da und als wäre dies nicht schon tragisch genug, findet er in Sarahs Sachen auch noch eine Metallkassette, die neben Jacobs Geburtsurkunde mehrere Zeitungsausschnitte von einer Säuglingsentführung enthält. Da Jacobs Geburtstag und das Datum der Entführung übereinstimmt kommt Ben ein böser Verdacht und schon bald hat er Gewissheit, dass Sarah vor sechs Jahren ihren »Sohn« entführt hat.
Ben will zunächst herausfinden, ob Jacobs leibliche Eltern noch leben und schaltet hierzu einen Privatdetektiv ein. Dieser spielt jedoch ein falsches Spiel und verkauft seine Informationen auch an Jacobs Vater, den Ex-Soldaten John Cole, der in zweiter Ehe mit Sandra verheiratet ist. Bei einem ersten eher zufälligen Treffen geht Cole auch gleich mit Gewalt gegen Ben vor, fordert seinen Sohn zurück und erhält nach einem entsprechenden Antrag das Sorgerecht. Fortan darf Ben seinen »Stiefsohn« nur noch einmal im Monat sehen, doch selbst dies wissen Sandra und Cole zu verhindern. Ben vermisst Jacob und bezweifelt zunehmend, dass es ihm in seiner neuen Umgebung gut geht. Bald gerät die Situation außer Kontrolle und Ben entschließt sich, aus einem Versteck heraus die Coles zu beobachten.
Schnell wird klar, dass Sandra in Abwesenheit ihres gewalttätigen Mannes, sich an andere Männer verkauft und Cole selbst offenbar erhebliche psychische Probleme hat. Da sich aber weder der zuständige Sozialarbeiter noch die Polizei an Cole herantrauen muss Ben eindeutige Beweise liefern. Tage lang liegt er mit seiner Kamera auf der Lauer. Dann eskaliert die Lage …
Der Stoff, aus dem die B-Movies sind
Die erste Hälfte des Romans liest sich ja noch recht flüssig und man rechnet Simon Beckett an, dass er einen nicht alltäglichen Plot erschaffen hat. Gut, die Idee ist nicht neu, lässt aber durchaus noch Gestaltungsspielraum zu. Leider wird die Geschichte aber geradeim zweiten Teil, wo ja eigentlich die Dramaturgie ihren Höhepunkt erreichen soll, immer flacher. Die eskalierende Gewaltspirale mit 08/15-Showdown ist weitestgehend vorhersehbar, außergewöhnliche Effekte oder Szenarios erwartet man vergebens.
Da hilft es leider nicht, dass der Autor frei nach dem Motto »Sex sells« die Seiten damit füllt, dass Ben seine voyeuristische Ader entdeckt. Mehr und mehr lenkt er seine Kamera von Cole und Jacob weg und beobachtet stattdessen Sandra beim An- und überwiegend Ausziehen. Mehrfach klappt ihr Bademantel auf unter dem sie zumeist nichts trägt, übrigens auch zur Freude ihrer heimlichen Kundschaft.
Der »heimliche Star« des Romans ist für mich die Randfigur des Sozialarbeiters Carlisle, denn er lebt offenbar in einem Paralleluniversum. Mit allen zur Verfügung stehenden schwarz-weiß Klischees ausgestattet, will er natürlich nur das Beste für Jacob. Obwohl schnell klar ist, dass Sandra als Prostituierte arbeitet und im Garten der Coles etliche Gegenstände liegen, an denen sich Jacob leicht verletzten könnte, sieht er den Jungen bei seinem Vater gut aufgehoben. Dass Ben ihn trotz Besuchsrecht nicht sehen kann, sei unerheblich. Das wird schon» und wichtig sei doch ohnehin nur, dass es dem Kind gut geht. Ähnlich seine erfrischend weltfremde Ansicht als er mit der Tatsache konfrontiert wird, dass Jacob nicht mehr zur Schule geht. Ja, so stellt man sich gemein hin einen Sozialarbeiter im negativen Sinn vor und dürfte zumindest in etlichen Fällen sogar noch richtig liegen.
Laut Aufkleber ein Bestseller
Alles in allem ist Obsession ein Werk, das ohne die aktuellen Erfolge des Autors sicher nicht noch einmal in den Regalen der Buchhändler aufgetaucht wäre. Doch was soll man auch von einem Buch erwarten, bei dem schon die kurze Inhaltsangabe des Buchrückens falsch ist? «Fassungslos informiert Ben die Behörden, die Jacobs leiblichen Vater schnell ermitteln.» Wie oben dargestellt, verläuft die Handlung völlig anders und so ist die Rückseite eine ebensolche Unverschämtheit wie die Titelseite, auf der ein Aufkleber den Roman als «Bestseller" ausweist.
Tiere
Die Worte der Überschrift mögen im Zusammenhang mit einem zu rezensierenden Roman ein wenig blasphemisch klingen, aber sie beschreiben das Ende der leidvollen Aufarbeitung von Simon Becketts Backkatalog. Alle, die sich versehentlich oder wider besseren Wissens dieses Machwerkes angetan haben, werden den Seufzer der Erlösung verstehen, den man am Ende der Lektüre ausstößt. Tiere (Animals, 1995) ist nach dem feinsinnigen Thriller (O-Ton,Beckett) Voyeur der zweite Roman aus der frühen Schaffensperiode (1994 – 1998) des Künstlers. Hatte sich für Voyeur (Fine Lines), damals noch als Galerie der Verführung ein deutscher Verlag (Droemer/Knaur) erbarmen können, sind die drei Folgeromane wohlweislich vom deutschen Verlagswesen ignoriert worden, obwohl gerade das hier vorliegende Tiere im Original mit dem Marlowe-Preis 1996 der Raymond Chandler-Gesellschaft ausgezeichnet wurde. Welchen Stellenwert man dieser Auszeichnung auch immer beimisst, den Autor erfüllt sie mit Stolz, wie er im Vorwort zur deutschen Erstausgabe von Tiere (2011) schreibt.
Sechzehn Jahre lag Animals verstaubend im Archiv und wäre dort mit Sicherheit auch liegen geblieben, wenn nicht mit Die Chemie des Todes (2006), dem ersten Roman der David-Hunter-Reihe, eine Beckett-Hysterie in Deutschland ausgebrochen wäre. Im Folgenden veröffentlichte der Rowohlt-Verlag Romane aus der überschätzten Hunter-Reihe und Becketts Frühwerke fragwürdiger Qualität im Wechsel – eine Strategie, die jedes Buch an die Spitzen der Hitparaden beförderte. Das Gesamtwerk des Autors wurde maximal ausgeschlachtet und optimal vermarktet – zwei durchschnittliche Krimis (Die Chemie des Todes & Kalte Asche) im Konzert mit sechs Nieten, unter denen Tiere den absoluten Tiefpunkt darstellt.
Tiere ist weder Thriller, wie ganz unverfroren auf dem Cover geschrieben steht, noch Roman. Bestenfalls könnte man es als unnötig in die Länge gezogene Kurzgeschichte bezeichnen, in der ein junger Mann einige Tage aus seinem Leben schildert.
Nigel ist Bürogehilfe im örtlichen Arbeitsamt und übt einfachste Tätigkeiten wie Fotokopieren und Botengänge aus. Er ist schlichten Gemüts und ohne Arg, deshalb ist er allseits wohlgelitten. Sein schüchternes, manchmal tolpatschiges Verhalten reizt die Kollegen dazu, harmlosen Schabernack mit ihm zu treiben, was er ihnen aber nicht übel nimmt. Außerhalb der Arbeit hat Nigel wenig soziale Kontakte. Er lebt allein in dem geschlossen Pub seiner verstorbenen Eltern. Fernsehen und Comics lesen füllen seine freie Zeit aus, wenn er sich nicht gerade um die Menschen kümmern muss, die er in seinem Keller gefangen hält. Warum er sie dort eingesperrt hat und wie Tiere behandelt, weiß er gar nicht so richtig. Eigentlich bedeuten sie ja nur Stress und Arbeit. Als seine Kolleginnen Karen und Cheryl zu Besuch kommen, hat Nigel nur Angst, dass sie seinem Geheimnis auf die Spur kommen könnten, was sie dann auch tun. Das war´s!
Was will uns der Autor mit dieser kleinen Geschichte sagen? Wenn überhaupt etwas! Anscheinend hat die Geschichte so viel Erklärungsbedarf erzeugt, dass der Autor sich für die deutsche Ausgabe zu einem klärenden Vorwort genötigt sah. Darin ist von mein bösester Roman...mit viel schwarzem Humor, denn der Leser soll lachen …die Rede. Von Humor, welcher Couleur auch immer, ist in dieser Geschichte nichts zu entdecken, wenn man davon absieht, dass da mal einer über eine Tasche stolpert oder ein anderer sich ein Bier über die Hose kippt, aber wer kann noch über solch infantilen Klamauk lachen? Richtig übel wird es, wenn man den Kern der Geschichte überdenkt: Nigel hält sich Menschen wie Tiere. Nicht irgendwelche Menschen, sondern die Ärmsten der Armen – Ausgestoßene, die eh am Rande der Gesellschaft leben – Obdachlose, Prostituierte, Alkoholiker und Junkies. Sie vegetieren dahin in Nigels Keller unter katastrophalen hygienischen Bedingungen, erniedrigt und gefoltert von einem harmlosen Bürschlein, der sogar Todesfälle billigend in Kauf nimmt. Ist das stimmig? Ist das lustig? Den Rezensenten hat das nur abgrundtief traurig gestimmt. Wieder mal einer, der sich auf Kosten Wehrloser zu amüsieren scheint. Passend zu noch ein Zitat aus dem Vorwort: »Keine Figur hat mir beim Schreiben so wenig Mühe gemacht wie Nigel, was bei näherer Betrachtung etwas bedenklich ist«. So viel Selbsterkenntnis ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Man will Simon Beckett nicht unterstellen, absichtlich in die falsche Schublade gegriffen zu haben. Festzustellen bleibt, dass sein Projekt »Versuch´s mal mit Humor« gründlich gescheitert ist. Manchen Menschen ist halt kein Humor gegeben oder sie sind unfähig, ihn in Worte zu fassen.
Nicht nur der Autor entlarvt sich hier, sondern auch die Person im Rowohlt-Verlag, die für die Überschrift auf der Rückseite des Buches verantwortlich ist. Dort steht geschrieben: – Manche Menschen sind wie Tiere – Wen meint er damit? Wohl kaum die armen eingepferchten Menschen, die ihre Verständnislosigkeit, ihre Ohnmacht durch die Gitter schreien. Auch nicht Nigel, den Erzähler, den der Autor zwar als Monster mit menschlichem Antlitz bezeichnet, es aber unterlässt, dessen Psyche entsprechend darzustellen. Es gibt nur einen, der von seinen tierischen Rudimenten dominiert wird – das ist Pete, einer von Nigels Gästen, der anscheinend nichts anderes kennt als Fressen, Saufen und Ficken.
Nach Meinung des Rezensenten dient der zitierte Satz allein dazu, potenzielle Voyeure zum Kauf des Buches zu animieren.
Tiere ist nichts weiter als gut verpackter, geschickt vermarkteter Müll, dessen Veröffentlichung ein Schlag ins Gesicht eines jeden ahnungslosen Lesers ist. Der Aufkleber »Bestseller« spottet dem Inhalt Hohn. Im Verlag reibt man sich genüsslich die Hände, die Enttäuschten und Düpierten gucken dumm aus der Wäsche, der Autor hat seinen guten Namen verspielt.
Das Schlechteste zuletzt zu servieren, war taktisch klug, aber der bittere Nachgeschmack wird den Lesern noch lange auf der Zunge haften. Allen Unentwegten, die immer noch nicht glauben wollen, dass Simon Beckett maßlos überschätzt ist, sei dringend zu Geduld geraten, bis Tiere auf den Grabbeltischen verramscht wird. Dort wird es mit Sicherheit zuhauf zu finden sein.