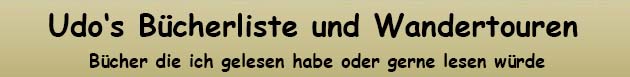Baxter, Stephen-Rezension
Das Multiversum 1 Zeit
Der erste Roman des neuen SF-Zyklus von Stephen Baxter spielt ein paar Jahrzehnte in der Zukunft. Für die menschliche Zivilisation hat sich noch nicht viel geändert, doch düstere Prognosen stürzen Teile der Bevölkerung in Depressionen, teilweise in Verzweiflung. Eine hochspekulative statistische Vorhersage gibt der Menschheit gerade noch 200 Jahre bis zum Untergang. Obwohl diese Terminierung durch nichts zu beweisen ist, wird sie von vielen als schicksalhafte, unwiderufliche Bestimmung angesehen. Doch nicht alle wollen dieses Schicksal hinnehmen.
Die Hauptfigur des Romans, Raid Malenfant, sieht eine Überlebensperspektive für die Menschheit nur in der Besiedlung des Weltraumes. Als verhinderter NASA-Astronaut setzt er alles daran, eine billige, gewinnbringende Raumfahrt zu installieren. Um aus dem Joch der bürokratischen, sich selbst behindernden staatlichen Raumfahrtunternehmen auszubrechen, gründet er eine Gesellschaft zur kommerzielen Ausbeutung von Asteroiden. Um die Funktionstüchtigkeit seines neuentwickelten Raketenantriebes zu demonstrieren, veranlaßt er einen Start ohne die vorgeschriebenen regierungsamtliche Genehmigungen einzuholen.
Als Malenfant, dieser böse Bube in den Einfluß eines geheimnisvollen Fremden namens Cornelius gerät, ändert er insgeheim seine Pläne. Der Fremde verfügt über ein unheimliches Wissen und erstaunliche Einsichten. Auf seine Veranlassung hin wird eine Apparatur konstruiert mit der man Botschaften aus der Zukunft empfangen kann. Und sie empfängt eine Botschaft, aus einer sehr fernen Zukunft...
Als wegen des ungenehmigten Starts die Schließung seines Unternehmens und damit das Ende seiner Raumflugpläne drohen, startet er illegalerweise mit seinem Raumschiff und einer kleinen, ganz besonderen Crew. Doch die Reise geht nicht zu dem ursprunglich angedachten besonders gewinnversprechenden Asteroiden sondern zu einem anderen Himmelskörper in Erdnähe, der die Sonne mysteriöserweise in wundersamer Kreisbahn umrundet. Auf diesem toten Steinbrocken gibt es nicht viel, nur einen großen, blauen Torbogen, der eine Verbindung zu anderen Zeitaltern, zu anderen Universen darstellt...
Stephen Baxter stößt in seinem neuen Roman die Tür zu neuen Universen auf, und er stößt sie verdammt weit und zu verdammt vielen Universen auf. Einmalig und atemberaubend, hinreißend die Schilderung seiner Protagonisten, sei es nun die automatische Robotsonde oder das Paar von Menschen, auf ihren Exkursionen durch die Mannigfaltigkeit der möglichen Universen.
Ich habe hier nur ein paar Teilstränge der komplexen Handlung wiedergegeben. Das Buch quillt geradezu über von phantastischen Ideen und spannenden Geschichten und bietet weit mehr als brilliante Hard-SF und die Extrapolation fundierter Theorien renommierter Kosmologen und Elementarphysiker. Das Multiversum: Zeit ist das neue Werk eines
Meisters der Science Fiction im ursprünglichen Sinne des Begriffes.
Die Zeitverschwörung 1 Imperator
Es war ein schwerer Tag, an dem Bricas Kind Nectovelin geboren wurde. Eine schwierige und schmerzhafte Geburt. Und es ist der Tag, von dem Cunovic, sein Onkel, glaubt, dass der Weber des Zeitteppichs seine Finger im Spiel hat. Und als das Kind endlich auf der Welt ist, murmelt die Mutter lateinische Verse, die sie eigentlich nicht kennen sollte. Cunovic, der Lateinisch gelernt hatte, schrieb mit und stellt bald fest, dass die Worte der sonst so stillen Bricas eine Prophezeiung darstellen.
Gut vierzig Jahre später lässt der römische Kaiser Claudius seine Legionen nach Britannien einmarschieren. Wie bekannt, sind die Römer zwar zahlenmäßig unterlegen, aber ihre strategischen Fähigkeiten zeigen, dass sie überlegen sind. Die Niederlage von Caratacus 51 nach Christus besiegelt Britanniens Schicksal. Allerdings wird in diesem Punkt die Prophezeiung falsch gedeutet. Die Römer breiten sich auf der Insel weiter aus, und die Prophezeiung gerät in Vergessenheit. Weitere 250 Jahre später ist das Christentum längst zur Staatsreligion geworden. Kaiser Konstantin sammelt Truppen für den Kampf im Osten des Imperiums, um dort wieder Ruhe und Frieden einkehren zu lassen. Mit dem Mordanschlag auf Kaiser Konstantin scheint sich aber die Prophezeiung wieder zu erfüllen.
Matthew Woodring Stover und John Maddox Roberts griffen die Thematik der römischen Besetzung Britanniens auf, sodass die Erzählung von Stephen Baxter nichts Neues anzubieten hat. Im Gegenteil, vieles erinnert mich viel zu sehr an andere Autoren, als dass ich in Imperator etwas Neues entdecken könnte. Zudem versucht er hier, in relativ kurzer Zeit ein paar Jahrhunderte Zeitgeschichte aufzuarbeiten, was er anhand der Erzählung nur mit großen Sprüngen durchführen kann. Dies wirkt sich auf die Lesbarkeit des Romans nicht positiv aus. Ich bin mir nicht sicher, was Stephen Baxter erzählen wollte. Einen historischen Roman, dann sind seine erfundenen Persönlichkeiten und die Prophezeiung verkehrt. Einen Fantasy-Roman, dann sind zu viele historische Fakten enthalten, die mir den Spaß verderben. Und dann der Reihentitel Die Zeit-Verschwörung. Für einen Zeitreiseroman fehlen eindeutige Hinweise, für einen epischen Roman die entsprechende Länge. Das Buch liest sich recht nett, und der englische Schriftsteller scheint sich sehr gut in der Geschichte Roms und Britanniens auszukennen, aber dieses Wissen setzt er auch bei seinen Lesern voraus. Im Großen und Ganzen wird nur die Geschichte Britanniens unter der Herrschaft des römischen Reiches erzählt. Ich versuche meine Erwartungshaltung bei ihm nicht in den Vordergrund treten zu lassen. Er als hervorragender Autor wird natürlich an seinen eigenen und anderen hervorragenden Romanen gemessen. Er startet hier den Versuch mit einer neuen Reihe und scheitert kläglich. Seinem zweiten Band gebe ich keine großen Chancen.
Stephen Baxter kann, wenn er will, aber hier wollte er wohl, weil er nicht anders konnte.
Die Zeitverschwörung 2 Eroberer
Der Prolog beginnt im Jahr 1066 nach Christus, endet mit den folgenschweren Worten "Wir sind in der falschen Zukunft, mein Freund. Und nun werden wir sie nicht mehr los" (Zitat von Seite 19), nur um im nächsten Kapitel ins Jahr 607 nach Christus zurückzugehen. Ein Sprung in der Zeit führt uns zum erneuten Auftauchen des Halleyschen Kometen im Jahr 793 mit der klösterlichen Blütezeit, nur um später in die Jahre von 878 bis 892, die Zeit Alfred des Großen; zu gehen. Letztlich landen wir im vierten Teil wieder in der Zeit von 1064 bis 1066 mit der Auseinandersetzung zwischen Harold Godwinson und Wilhelm, dem Herzog der Normandie, und schlagen damit wieder den Bogen zum Prolog.
Das Ereignis des Jahres ist die Wiederkehr des Halleyschen Kometen, der in unregelmäßigen Abständen am nächtlichen Sternenhimmel zu sehen ist. Mit seiner Ankunft erschreckt er die Menschen, und viele sehen in ihm ein Unheil, in jedem Fall aber einen Umbruch im Leben der Gläubigen. Es ist die Zeit, da die Römer die britischen Inseln verlassen haben und sich die Sachsen den Hinterlassenschaften annehmen. Einer der jungen Sachsen ist Wuffa, ein fähiger Krieger. Er ist es, der von einer Prophezeiung erfährt: dem Menologium der Isolde. Wuffa ist der Meinung, dass Teile der Weissagung bereits eingetreten sind. Etwa, dass der Wolf des Nordens in Person der Nordmänner den britischen Bären erlegten und das Land übernehmen wird. Andere Sachen, wie ein zehntausendjähriges arisches Reich, sind ihm fremd und bereiten ihm Kopfzerbrechen. Bewahrt wird das Menologium der Isolde von dem angeblich letzten Römer in Britannien, Ambrosias. Wuffa macht sich auf den Weg in den Norden, begleitet von seinem Freund Ulf. Als sie bei Ambrosias ankommen, ist dieser durchaus bereit, drei Fremde in die Prophezeiung einzuweihen: Wuffa und Ulf und die hübsche Britin Sulpicia. Die beiden Männer sind jedoch nicht nur an der Weissagung interessiert, sondern auch an der Frau. Diese Leidenschaft und Begehrlichkeit macht sie alsbald zu Rivalen um die Gunst der schönen Sulpicia.
In den weiteren Teilen ändern sich zwangsläufig die handelnden Figuren. Doch immer steht die Ankunft des Kometen im Mittelpunkt. So auch im letzten Teil, wo sich William der Eroberer vom Erzbischof zum neuen König ernennen lässt. Doch die Krönung steht unter keinem guten Stern, denn während die Anwesenden i Westminster jubeln, halten das die Wachen vor dem Haus für einen Aufstand und stürmen die Halle. Die dortigen Adligen und ihr Gefolge fühlen sich angegriffen und wehren sich natürlich. Ein wildes Gemetzel beginnt. Und wie sagt Sihtric doch (auf Seite 555): " Welch blutige Posse." Damit ist dann auch schon alles gesagt. Die Frage, die sich nach dem Fall des römischen Reiches in Imperator und Aufstieg und Fall in Eroberer stellt, ist doch: Hat sich die Prophezeiung erfüllt? Wird sich die Voraussicht des Zeitenwebers erfüllen? Was der Weber damit jedoch sagen will, bleibt im Dunkeln. Auch die Frage, ob mit der Prophezeiung erst der Weg für die vorausgesagte Zukunft bereitet werden soll, bleibt unbeantwortet.
Im Menologium der Isolde wird auf Grund des (historisch tatsächlichen) Erscheinens des Kometen über geschichtliche Ereignisse geschrieben. Diese Datumsangaben, so versichert Stephen Baxter in seinem Nachwort, sind verbürgt und entsprechen dem Stand der Forschung. Dadurch habe ich den Eindruck, hier wird erst einmal Geschichtsunterricht wiederholt. Eine eigenständige Erzählung, eher episodenhaft, wird nicht geboten. So hätte man aus den ersten drei Kapiteln spannendere Kurzgeschichten schreiben können und aus der Episode zwischen Harold Godwinson und Wilhelm dem Eroberer einen Kurzroman. Vielleicht gerade deswegen bietet der zweite Roman nicht viel Neues, und vieles, was bereits im vorherigen Band stand, wiederholt sich hier. Stephen Baxter kann gut schreiben, mit der vorliegenden und etwas eigenwilligen Unterrichtsstunde in Geschichte bin ich aber ein wenig unzufrieden. Vielleicht sind meine Erwartungen inzwischen etwas zu hoch angesiedelt. Es ist in jedem Fall keine Science Fiction zu deutsch, wissenschaftliche Zukunftserzählung, sondern eher eine Art alternativer historischer Roman.
Drei Punkte, die ich gern geklärt hätte: Warum werden die Zeichner von Titelbild und Karte nicht mehr genannt, warum heißt es bei Peter Robert in der Übersetzung Mönchin und nicht Nonne?
Die Zeitverschwörung 3 Navigator
Stephen Baxters Zeit-Verschwörungs-Reihe besteht insgesamt aus vier Romanen, von denen bisher drei auf Deutsch erschienen sind. Zugleich spaltete Baxter die SF-Fans in zwei Gruppen. Die einen sind von seinen neuen Romanen angetan, die anderen fragen sich, was daran SF sein soll. Wahrscheinlich provozierte Baxter auch viele zu große und evtl. auch falsche Erwartungen. Wie dem auch sei, wer einen klassischen Zeitreiseroman erwartet, wird auf jeden Fall enttäuscht sein. Vielmehr geht es Baxter darum, dass jemand in einer unbestimmten Zukunft anscheinend eine Technik entwickelt hat, mit der er Botschaften in Form von Prophezeiungen in die Vergangenheit schicken kann. Originell bei Baxter ist nun, dass er beschreibt, wie die jeweiligen Menschen der Antike oder des Mittelalters und im dritten Band der Renaissance auf diese seltsamen Botschaften reagieren. Dabei lässt es Baxter nicht an bitterer Ironie fehlen, denn die Menschen aller Epochen reagieren leider allzumenschlich: Die Botschaften werden genutzt, um daraus Profit zu schlagen. Dies gelingt Baxter in "Imperator" auf sehr spannende Weise. "Eroberer" dagegen entpuppt sich als ziemlich schwacher Roman, mit wenig Spannung und viel Schwulst. Der dritte Teil ist eindeutig der bisher beste innerhalb dieser Reihe.
Es geht in diesem Band um zwei Prophezeiungen. Die eine beschreibt, wie man "Gottes Maschinen" bauen kann, die andere warnt davor, was passieren würde, wenn Columbus nicht seine Entdeckungsreise unternimmt. Baxter packt hierbei sämtliche aktuellen Themen, wie religiösen Fanatismus, Herrschsucht und Profitgier, in einen Topf und rührt ein paar Mal kräftig um. Heraus kam kein unbedingt spannender, aber durchaus witziger Roman, der versucht, die Schwächen seiner Vorgänger zu umgehen. Dennoch bleiben die Charaktere sehr oberflächlich. Baxter baut ein paar recht originelle Ideen ein, wie z. B. einen Bericht aus der Zukunft, der von einer Welt spricht, in der die Inka Europa eingenommen haben und dort nun ihre grausamen Menschenopfer zelebrieren. Wie auch in den vorangegangenen Büchern fühlen sich die einen Protagonisten gewarnt, während die anderen sich durch die Erfüllung der Prophezeiungen Macht und Reichtum versprechen. Die Spekulationen über den sog. "Zeit-Weber", die in "Imperator" aufkamen, werden hier weitergeführt. Allerdings scheint es nun zwei Weber zu geben. Dadurch bleibt man als Leser ziemlich verwirrt zurück, denn was hätten solche zukünftigen Szenarien wie die Eroberung Europas durch die Inka für einen der beiden Weber für einen Sinn? In Band Vier mit dem Titel "Diktator", bei dem anscheinend Nazi-Deutschland eine nicht unwesentliche Rolle spielen soll, wird anscheinend die Identität des bzw. der Zeit-Weber geklärt werden. Ob es wieder einmal die bösen Deutschen sind?
Insgesamt hat mir "Navigator" recht gut gefallen, da hier Baxter etwas mehr in Schwung kommt und dem Leser mit teils originellen Ideen aufwartet. Besonders witzig finde ich die Stelle, in der Roger Bacon versucht, das Rätsel um die Gottes-Maschinen zu lösen. Hier kommt sogar ein klein wenig Steampunk auf.
Die Zeitverschwörung 4 Diktator
Mit Band Vier seines umstrittenen Werkes über den Zeitweber ist Stephen Baxter schließlich in der Zeit des Zweiten Weltkrieges angekommen. Was bisher viele Leser an Baxters Reihe gestört hat, ist das Fehlen von Science Fiction in Romanen, die als Zeit-Verschwörung tituliert sind und noch dazu den herrlichen Heyne-Spruch: „Wer manipuliert die menschliche Geschichte?“ tragen. Und hier fängt es schon an: Wieso eigentlich nicht „die Geschichte der Menschheit?“ Klingt zumindest weniger holprig. Und da sind wir eigentlich schon bei unserem Stichwort: holprig. Ich glaube, das trifft im Grunde genommen auf die gesamten vier Bände zu. Doch dazu am Schluss mehr.
Zunächst der lang ersehnte (?) vierte Band und damit der Abschluss der Reihe. Im Grunde genommen spielt der gesamte Roman bereits in einer veränderten Historie und damit in einer Art Parallelwelt. Wir schreiben das Jahr 1940 und die Deutschen sind dabei, England zu erobern. Das gelingt ihnen zum Teil, so dass sie daraufhin das Protektorat Albion errichten, wo u. a. versucht wird, eine Herrenrasse zu züchten. Gleichzeitig versucht die SS mithilfe einer Art Rechenmaschine, die Vergangenheit zu beeinflussen. Dadurch soll es gelingen, das 1000-jährige Reich zu errichten. Als nun die USA in den Krieg eintritt, will man damit erreichen, dass die USA erst gar nicht entsteht. Die Maschine alleine reicht allerdings nicht aus, denn man benötigt zusätzlich noch einen „Weber“, der die Fähigkeit besitzt, in seinen Träumen Botschaften in die Vergangenheit zu schicken. Diesen Weber finden die Nazis in Ben Kamen, einem österreichischen Juden, der Mitarbeiter bei Kurt Gödel gewesen ist und sich bereits selbst mit der Manipulation von Geschichte beschäftigt hat. Natürlich finden die Engländer heraus, was die Nazis wollen, und versuchen, das Experiment zu stoppen.
Eigentlich hätte sich der Roman um diese Geschehnisse drehen sollen. Tut er aber nicht. Denn in Wirklichkeit erscheinen diese Experimente und der Versuch, diese zu stoppen, nur am Rande. Der Großteil des Romans ist ein normaler Kriegsroman, auch wenn er in einer parallel verlaufenden Historie spielt. Baxter verarbeitet darin Sachbücher über den Zweiten Weltkrieg und verliert dabei das eigentliche Ziel und die eigentliche Story völlig aus den Augen. Zum Zweiten verzettelt sich Baxter selbst in seinem besonders in Band Drei aufgebauten Spannungsbogen. In Band Drei wird aus der Zukunft eine Art Tonbandgerät in das Zelt des Großkhans geschickt, dessen gespeicherte Botschaft dazu verleiten soll, den Khan zu ermorden. Diesen Zwischenfall findet auch der britische Geheimdienst heraus. Die Frage ist nun, wie das gelingen kann, wenn die Nazis doch nur Gedanken in die Vergangenheit schicken können? Die lapidare Antwort: wahrscheinlich hat jemand in ferner Zukunft
Drückt man beide Augen zu, so kann man Baxters Roman noch in die Reihe von englischer SF einordnen, welche die sogenannte Splendid Isolation in Gefahr sieht. Diese typisch britische Angst hat jedoch Saki vor knapp 100 Jahren mit seinem Roman „Als Wilhelm kam“ weitaus besser und witziger verarbeitet. Baxter selbst brilliert hier vor allem durch eine radikale Einfallslosigkeit. Dies trifft ebenso auf die doch recht platten Charaktere zu, angefangen von Ben Kamen, über Josef Trojan bis hin zu Mary Wooler.
Was ist nun von der Reihe als Ganzes zu halten? Die Idee der Geschichtsmanipulation aus Sicht der jeweiligen Zeitgenossen bzw. Betroffenen zu erzählen, war sicherlich recht originell. Leider aber verpasste es Baxter, seine Romane mit Ideen zu würzen. So plätschert ein Buch nach dem anderen vor sich hin und lässt dabei vor allem eines vermissen: Science Fiction. Nur Band Drei ragt hierbei etwas hervor, da Baxter in diesem Roman in die Fußstapfen des Steampunk tritt und dadurch für kurze Momente recht nette Ideen entwirft. Band Vier allerdings ist eine reine Enttäuschung. Man könnte auch sagen „Baxter at his worst“. Hoffentlich macht er so etwas nicht wieder.
Flood 1 Die letzte Flut
Was tut man, wenn man als Rezensent einem Roman gleichgültig gegenübersteht, dem die meisten britischen Kommentatoren hohes Lob zollen? In meinem Fall führte das dazu, dass ich mir verschiedene Kritiken näher ansah und dann doch eine fand, die im Wesentlichen meine Einwände teilte - und klarer formulierte. Mein Hauptargument gegen Stephen Baxters Roman Die letzte Flut habe ich bei Graham Sleight (hier) entlehnt. Es hat viel mit der britischen Science-Fiction-Tradition zu tun und den Erwartungen, die der Leser typischerweise mit Katastrophenromanen einerseits und scientific romances andererseits verbindet. Dazu im Einzelnen später mehr. Zunächst lässt sich aber schon klar feststellen, dass wir es bei Flut nicht mit einer cosy catastrophe zu tun haben - was ein 1973 von Brian Aldiss [2] eingeführter Terminus für Romane ist, in denen die Welt ein ‚bisschen’ untergeht, um dann von zupackenden Menschen wieder aufgebaut zu werden.
Solch einen einfachen Ausweg hält sich Flut zu keinem Zeitpunkt offen. Die Romanhandlung setzt 2016 ein, in Barcelona. Nach fünf Jahren in der Gewalt einer katalanischen Terrorgruppe werden vier Menschen durch Intervention des Industriellen Nathan Lammockson aus ihrer Geiselhaft befreit: die amerikanische Hubschrauberpilotin Lily Brooke, der britische Offizier Piers Michaelmas, der Nasa-Wissenschaftler Gary Boyle sowie Helen Gray mit ihrem Baby Grace (Helen wurde von ihren Entführern vergewaltigt). Bei ihrer Rückkehr in die Zivilisation finden diese Menschen eine Welt im Umbruch vor, in der schon seit Jahren die Meere ansteigen. Lily (sicher die Hauptperson des Romans) erlebt bei ihrer Rückkehr nach London die Überflutung der Themse-Barriere und halb Londons mit und das ist erst der Anfang.
Ziemlich bald wird in diesem Roman klar, dass alle Landmassen der Erde zum Untergang im Meer verurteilt sind. Doch wie kann das passieren? Selbst wenn alles Eis der Antarktis schmölze, stiege der Meeresspiegel nur um wenige hundert Meter. Stephen Baxter greift für sein Werk auf - angeblich nicht völlig an den Haaren herbeigezogene - Denkmodelle zurück, denen zufolge im Erdmantel gigantische Wasservorkommen existieren. Als diese beginnen, erst langsam und dann immer schneller, in die Weltmeere zu ‚lecken’, steigt der Meeresspiegel unaufhaltsam. Es wird offensichtlich, dass die Tage der menschlichen Zivilisation, wie wir sie kennen, gezählt sind.
Gerade diesem Wissen um die Unabwendbarkeit - und der dadurch entstehenden Atmosphäre - verdankt Flut einen großen Teil seiner Wirkung. Baxters nüchterne, ausgesprochen distanzierte Erzählweise lässt nie die Hoffnung aufkommen, früher oder später werde schon ein begnadeter Wissenschaftler auf den Plan treten und die Welt retten. Dort, wo sein Roman funktioniert und den Leser berührt, tut er das, weil er die britische Tradition der scientific romance aufgreift und nutzbringend einsetzt. Seit den Zeiten H.G. Wells’ bürgerte sich dieser Begriff als Bezeichnung für die britische Zukunftserzählung ein. Als sich jedoch nach dem 2. Weltkrieg auch im Vereinigten Königreich die Gattungsbezeichnung ‚Science Fiction’ durchsetzte, nahm der Terminus ‚s. r.’ eine neue, abgewandelte Bedeutung an. Heutzutage bezeichnet man als scientific romances meist Geschichten
„ characterized by long evolutionary perspectives; by an absence of much sense of the frontier and a scarcity of pulp-magazine-derived hero who is designed to penetrate any frontier available; and in general by a tone moderately less hopeful about the future than that typical of genre sf until recent decades.“ [3]
In scientific romances vergeht tendenziell viel Zeit. Es gibt keine typisch amerikanische Can-Do-Mentalität, keine Helden und eigentlich überhaupt keine Charaktere. Graham Sleight sagt auf der oben verlinkten Seite sinngemäß, in scientific romances werde die Kamera auf spektakuläre Ereignisse gerichtet. Welche einzelnen Menschen mit ins Bild geraten, ist dabei zweitrangig. Genau hier scheint mir das Hauptproblem von Flut zu liegen: Dieser Roman kommt über weite Strecken wie ein Katastrophenroman daher und wird doch nur dann interessanter, wenn er der Tradition der scientific romance folgt. Stephen Baxter führt in Barcelona die meisten seiner Hauptpersonen ein und lässt sie versprechen, auch nach ihrer Befreiung immer für einander da zu sein. Dies ist die erzählerische Klammer, die fortan das Buch zusammenhält - leider aber auch nicht mehr. Der Buchanfang suggeriert dem Leser, er habe es mit einem Katastrophenroman zu tun, also der Art Werk, wo zuerst eine größere Schar Personen samt persönlichem Hintergrund eingeführt wird und diese dann jede Menge Freud, Leid, Abenteuer erleben, bei dem man als Leser mitfiebert - und -leidet. Flut allerdings macht Versprechungen, die es nicht einhält. Denn Stephen Baxter ist auch in diesem Buch Stephen Baxter, und das heißt: In diesem Roman treten keine Charaktere auf, die dem Leser in irgendeiner Weise nahe gehen. Es ist nicht so, als ob die Personen unsinnige oder unglaubwürdige Dinge täten. Ganz im Gegenteil: Baxter erweist ihnen eine Menge Respekt dadurch, dass er sie völlig realistisch skizziert. Nur füllt er sie nicht mit Leben. Dieses Buch deckt auf seinen 750 (reichlich dünn bedruckten, aber dadurch auch lesefreundlichen) Seiten (plus vier tollen Weltkarten) fast vierzig Jahre ab. Dabei verweilt es meist einige Dutzend Seiten bei einer Szene, um dann mehrere Jahre in die Zukunft zu springen. Bei solch einer Buchstruktur bleibt schwerlich Zeit für Charakterzeichnung, zumal wenn der Erzähler gleichzeitig noch den Verlauf der jüngsten Weltgeschichte referieren muss und Dialoge zwischen den handelnden Personen oft aus technischem Infodump bestehen. Ich erinnere mich an eine seltene Szene in der Mitte des Romans, in der ein dramatischer Streit in der Familie von Lily Brookes Schwester geschildert wurde. Diese Stelle ließ mich nicht nur gelangweilt zurück - ich fühlte mich richtiggehend belästigt: Was sollte das? Hatten Autor und Leser sich nicht längst stillschweigend geeinigt, dass die Personen hier nicht von Belang waren? Warum also Seifenopereinlagen?
Kehren wir darum einmal zu den großen Panoramabildern, den spektakulären ‚Kameraeinstellungen’ zurück. Vor allem diese sind es, die in den nicht wenigen positiven Rezensionen besonders gelobt werden.
Da wäre erstens der Untergang unserer Zivilisation: Stellen Sie sich vor, die Landmassen unseres Planeten versänken wirklich langsam im Meer. Was wäre die Folge? - Nun ja, höchstwahrscheinlich Lebensmittelknappheit, Massenmigration, Kriege um das verbliebene Land, der Zusammenbruch der Staaten und am Ende Kannibalismus. Genau, das passiert auch in Die letzte Flut, und zwar in aller Regel im ‚Off’' - zwei Menschen sitzen womöglich zusammen und reden darüber. Die meiste Zeit passiert also nichts Überraschendes. Höchstens hatte ich gelegentlich bei der Lektüre Aha-Erlebnisse, wenn Stephen Baxter sein Wissen ausbreitete. So reiste Gary Boyle in einer Szene in den Kaukasus, um zu beobachten, wie das ansteigende Schwarze Meer die Ebene zum Kaspischen Meer überfluten würde, und ich als Leser erfuhr, dass solch ein Prozess Jahre dauert. Man könnte also langsam vor der ‚Flutwelle’ herspazieren. Wirklich interessant. Genauso wie die Tatsache, dass in einer Million Jahre als letzte Relikte unserer Spezies noch die Unmengen Plastik über die Meere treiben werden, die wir heute schon nach dem Prinzip Nach mir die Sintflut produzieren und wegwerfen.
Der zweite, oft genannte Punkt sind die Katastrophenbilder. Der Unternehmer Lammockson baut in den Anden den Ozeanriesen Queen Mary nach und schippert damit anschließend durch die Welt (Stichworte: Arche und, natürlich, Anklänge an die biblische Sintflut). Wenn dieser Dampfer dann das versunkene London passiert, finden dieses Bild viele Leser sicher malerisch, faszinierend. Na, vielleicht, eigentlich wusste der Romantext aber nicht viel mit dieser Szenerie anzufangen.
Und so kommen wir zum Ende der Geschichte, die hier endlich durch ihre Scientific-romance-Eigenschaften punkten kann. In diesem letzten Teil vergeht die Zeit besonders schnell, die Lebensbedingungen ändern sich drastisch, die noch lebenden Protagonisten sind hochbetagt und um die Zukunft der Menscheit steht es eher schlecht. Die größte Hoffnung scheint da noch ein Sternenschiff, das die Vereinigten Staaten in ihren letzten Tagen ins Weltall schossen. An Bord das einstige Baby Grace Gray? Auch das wissen wir nicht mit letzter Sicherheit, da auch diese Entscheidung im ‚Off’ ablief. Genaueres erfährt der geneigte Leser vermutlich in Stephen Baxters Space-Opera-Fortsetzung Ark. Ich eher nicht, ich werde künftig wohl anderen Neigungen frönen.
Flood 2 Die Letzte Arche
Die Zukunft: Eine gewaltige Flut hat die Erde unbewohnbar gemacht. Die wenigen Überlebenden versuchen verzweifelt, die Zivilisation aufrechtzuerhalten. Doch es wird immer deutlicher, dass es für die Menschheit nur einen Ausweg gibt: die Suche nach einer zweiten Heimat in den Weiten des Alls ... (Klappentext)
Man könnte fast meinen, Stephen Baxter habe den angeblichen Maya-Kalender als Aufhänger genommen, wenn bei ihm im Jahr 2012 die Welt untergeht. Die Erde wird überflutet, weil aus unbekannten Tiefen der Erde sich Grundwasser in die Meere drückt und dafür sorgt, dass allerorten der Meeresspiegel steigt. Die Ozeanografin Thandie Jones hat mit ihrer Voraussage recht: Alles Land versinkt. Sind zunächst nur die Küsten betroffen, ergeben sich bald entlang der Flüsse bis ins Landesinnere Probleme. Wer kann, der flieht in die Berge, um dort zu überleben. Dort sind die Böden karg, eine Landwirtschaft findet nur eingeschränkt statt, weil immer mehr Menschen sich in die Höhe retten. Lebensmittelknappheit, Krankheit, Gewaltbereitschaft sind Themen, die die Gemeinschaft beherrschen. Und allen voran ein Heer entwurzelter Menschen ist unterwegs wie eine Heuschreckenplage. Die einzige Ordnungskraft ist das Militär. So wird aus dem Planeten Erde, dessen Oberfläche zu 70 Prozent von Wasser bedeckt war, ein Wasserplanet, dessen Landanteil auf 10 und weniger Prozent verringert wird. Damit einhergehend ändern sich die Art des Zusammenlebens und die soziale Struktur.
In den USA (wo sonst) hat man den überlichtschnellen Flug erfunden. Man baut 2025 ein Raumschiff, eine letzte Arche (der Namensgeber), mit der achtzig junge Männer und Frauen 2042 ins All geschickt werden. Bereits in Die letzte Flut existierten mehrere Archen, die für das Überleben einiger weniger Menschen sorgen sollten. Ziel ist ein Planet, der als Erde II besiedelt werden soll und der Menschheit ein Überleben garantiert. Der Start gelingt und die neue Heimat rückt immer näher. Die Technik funktioniert einigermaßen, doch das Zusammenleben ist nicht gegeben. Ähnlich wie in vielen anderen Erzählungen mit Menschen auf engem Raum beginnen sich Grüppchen zu bilden und so wird aus der Science Fiction eine Social Fiction, allerdings nicht sehr intensiv beschrieben. Die Mannschaft der Arche zerbricht an der Enge und den unterschiedlichen Interessen, was bis zum Mord an den Kameraden führt. So erreicht den neuen Zufluchtsort, Erde II, eine dezimierte Mannschaft. Der Planet stellt sich als unbewohnbar heraus. Für die Besatzung der Arche stellt sich eine überlebenswichtige Frage: zurück zur Erde oder Weiterflug in eine ungewisse Zukunft?
Stephen Baxter greift das Thema des Untergangs auf. Der britische Schriftsteller, Sohn einer Seefahrernation, kämpft mit dem Wasser. Er lässt nicht nur seine Protagonisten, sondern auch den Leser alles haarklein durchleben. Was 2012 beginnt und mit dem Start des Raumschiffes 30 Jahre später vorläufig endet, danach bis zum Jahr 2082 weitergeführt wird, ist das Lebensalter eines Menschen. Doch welcher Mensch wird beschrieben? Man kann die Personen x-beliebig austauschen, sie sind nur ein ganz kleiner Teil, der zufällig überlebte. Hier lässt Baxter gern seitenlang Gespräche einfließen, lässt für eine Zeit die Handlung beiseite, bis er sich entschließt, den Handlungsstrang zu wechseln, um das Geschehen zu beschleunigen. Menschenmassen sterben in steigenden Fluten und bleiben, was sie sind, eine gesichtslose und gleichsam tote Masse. Aus dieser Masse treten einige wenige Personen hervor, lassen den Leser an ihrem imaginären Leben teilhaben. In seinem episodenhaften Roman lässt der Autor vieles offen. Der Leser muss sich selbst einiges zusammenreimen. Bis zum Ende des Buches blieben die Handlungsstränge unaufgelöst, und der Leser muss die Fortsetzung (?) abwarten. Stephen Baxter hält die Fäden in jedem Fall in der Hand. Ab und zu sorgt er für Überraschungen, wenn Wendungen eintreten, mit denen der Leser nicht gerechnet hat. Damit ist Die letzte Arche ein typischer Stephen Baxter: abstrakt, aber nachvollziehbar, ebenso wie Die letzte Flut. Zudem liegt die Zukunft offen vor uns. Man muss sie nur zu lesen wissen.
Die letzte Frage, die sich mir als Mensch stellt, ist: Warum soll ein unwichtiges Grüppchen der Menschheit überleben?
Kinder des Schicksals 1 (Xeelee 6) Der Orden
Im Nachlass seines gerade verstorbenen Vaters findet George Poole ein Foto, an das er sich gar nicht mehr erinnern kann. Es zeigt ihn mit seiner älteren Schwester und einem gleichaltrigen Mädchen, dass seine Zwillingsschwester sein könnte. Die Schwester die er nie richtig kennen lernen konnte, da sie gänzlich aus seinem Gedächtnis gestrichen wurde und schon sehr früh das Elternhaus verliess. Ein mysteriöser Orden nahm sie in ihre Obhut und bei der Durchsicht der Dokumente findet George Kontoauszüge, aus denen hervorgeht, dass sein Vater bis zu seinem Tod an diesen Orden bezahlte. Da George gerade in einem Tief steckt und sein gut bezahlter Posten wohl bald in Arbeitslosigkeit mündet, nimmt er sich eine ‚Auszeit’ und beschliesst seine Schwester zu suchen. Mit einem Umweg über die Vereinigten Staaten erfährt er von diesem seltsamen Orden, den doch wieder niemand kennt, aber in der nähe des Vatikans angesiedelt ist und dort doch bekannt sein sollte. Dabei findet er heraus, dass seine Eltern aus Geldnot seine Schwester an diesen ominösen Orden verkauften. Dabei stellt sich bei weiteren Nachforschungen heraus, dass seine Eltern von der Ordensgründerin abstammen.
Rückblende:
Auf dem Dachboden findet er neben alten Comics auch eine Bildergeschichte, die seine ältere Schwester einmal in der Art von Comic erzählte. Es ist die Geschichte der Auslands-Römerin Regina.
Noch viel früher:
Scheinbar gibt es die Vorfahrin Regina tatsächlich. Im vierten jahrhundert nach Christus lebte sie mit ihren Eltern in Britannien. Das Reich war im Niedergang begriffen, die besetzten Länder warfen nach und nach das Joch der Unterdrückung ab. Regina wuchs im unsicheren Britannien auf, dessen römische Grenzen dort von einfallenden Sachsen immer mehr bedroht wurden. In jener Zeit wurde Regina mit ihrem Grossvater nach Rom verschlagen. Auch hier bemerkte das junge Mädchen den fortschreitenden Niedergang und suchte und fand einen Zufluchtsort für ihre Familie. Die Eltern von ihr starben bei einem Eifersuchtsdrama in Britannien, warum auch ihr Grossvater sie zu sich nahm. Mit ihrer neuen Familie fand sie dann in Rom eine Zuflucht, die sich Jahre später bei der Plünderung Roms durch die Vandalen auch bestens bewährte. Aus dieser Zuflucht heraus entstand ein Orden, der das Überleben der weiblichen Mitglieder durch alle Wirren der noch kommenden Zeiten ermöglichen sollte. Nach etwa anderthalb Jahrtausenden bewirkte der Orden bei seinen Mitgliedern sehr anschauliche Veränderungen. Der Handlungsträger George Poole fühlt sich von der Familie seltsam angezogen. Gleichzeitig fühlt er sich aber auch abgestossen und ist über verschiedene Dinge äusserst entsetzt. Tausende weibliche Ordensmitglieder leben tief unter den Kellern Roms in der sogenannten Krypta, um dort als Gebährmaschinen zu leben. Der Orden selbst handelt mit Informationen, Genetischen Einzelheiten und vieles mehr. Vor allem weil der Orden lückenlose Aufzeichnungen von 1600 Jahren zur Verfügung hat, kann er sich diesem Geschäftszweig annehmen. Doch das ist bei weitem nicht der Hauptpunkt. Georges Freund, Peter, der eine Zeitlang sich um Georges Vater kümmerte, ist ein Verschwörungstheoretiker. Gemeinsam kommen sie den Gebärmaschinen auf ihr Geheimnis. Die Schwestern des Ordens sind wohl so etwas wie eine Horde Ameisenköniginnen, die nichts anderes tun, als Kinder auf die Welt zu bringen. Andere Frauen dieser Gemeinschaft haben andere Aufgaben. Letztlich ist es ein Rückschritt der Menschheit hin zu einem Ameisenstaat.
Der neue Roman von Stephen Baxter ist, obwohl so ausgezeichnet, kein Science Fiction Roman. Nur weil ein paar Abschnitte in der Zukunft spielen, und somit schon von vornherein das Ende wegnehmen. Genausowenig ist der Roman ein Fantasy-Roman, nur weil auf die Arthus-Saga erwähnt wird und in der römischen Vergangenheit spielt. Nebenbei gibt es immer wieder belanglose Erwähnungen von astronomischen Ereignissen, die wie vieles Andere, überhaupt nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun haben. Der Thriller wird hingegen auch nicht seinem Namen gerecht, da das Buch über lange Strecken recht langweilig wird. Seine Charakterisierung der Personen ist manchmal recht originell, doch reissen sie die Handlung nicht gerade aus ihrem Tief heraus. Meine Spannung bestand darin, darauf zu warten, dass es spannend wurde. Während Stephen Baxter für mich in anderen Romane ein durchaus guter bis sehr guter Autor ist, legt er mit ‚Der Orden’ ein eher unterdurchschnittliches Werk vor. An ihm scheiden sich die Kritiker in solche, die ihn gut finden, und solche, die ihn schlecht finden.
Kinder des Schicksals 2 (Xeelee 7) Sternenkinder
Was in dem Roman DER ORDEN begann, wird in STERNENKINDER beharrlich weitergeführt. Warum der englische Titel, der genauso folgerichtig mit FROHLOCKEN übersetzt werden könnte, in Sternenkinder umgetauft wurde, weiß wahrscheinlich nur die Marketingabteilung.
Von der Menschheit wird seit Jahrtausenden der Krieg gegen die Xeelee geführt. Die Kräfte der Menschheit schwinden dahin, die Krieger werden immer jünger, und mit neunzehn Jahren gilt man inzwischen als Veteran des immerwährenden Krieges. Kinder und Jugendliche sind es, die die Hauptdarsteller des Romans stellen. Die Handlung ist mit den dürren Worten bereits beschrieben. Stephen Baxter ist ein Autor, der schreiben kann. Er schafft es, innerhalb der Erzählung in Kleinigkeiten abzuschweifen, große Handlungsbögen aufzubauen um wieder an den Ausgangspunkt zurückzukommen. Während andere Romanautoren geradlinig auf ein Ziel zusteuern, wählt er seinen Weg spiralförmig. Was mir an diesem Roman besonders gefiel, waren die Zeitparadoxa, die er aufbaute. Und mehr als einmal ertappte ich mich dabei, gar nicht darüber lesen zu wollen, da Paradoxa die unangenehme Art haben, sich nicht nur selbst zu erzeugen, sondern aus der Logik heraus sich eigentlich als Logikwölkchen auflösen zu müssen. Nur, wenn sie sich gleich wieder auflösen, bestehen sie eigentlich nicht lange genug, um sich selbst lebensfähig zu halten.
Die Handlungsträger, allen voran Pirius und seine Staffelkollegen und -kolleginnen, sind sehr schön beschrieben. Ihre Sorgen und Ängste ebenso wie ihre Erfolge, Liebe und Zerwürfnisse. Es ist Leben pur, das doch in dem Krieg Mensch gegen Xeelee (Sili gesprochen), so kurz ist. Die Beschreibung Stephen Baxters von der Entstehung des Universums, den Quagmiten, Quarks, Baby-Universen, Monaden und ähnlichem mehr, ist man gewillt zu überlesen, da sie zuerst nur verwirren und zu wissenschaftlich sind. Sie dienen trotzdem dem besseren Verständnis und sollten nicht außer Acht gelassen werden. Sicher, das Buch hätte nicht unbedingt 700 Seiten gebraucht, um diese Geschichte zu erzählen. Aber so ist eben der Autor, dessen Bücher bisher immer Ziegelsteinformat besaßen.
Kinder des Schicksals 3 (Xeelee 8) Transzendenz
„Transzendenz“ ist die lose Fortsetzung der Romane „Der Orden“ und „Sternenkinder“, man kann das Buch aber auch bedenkenlos ohne Vorkenntnisse lesen. Die Handlung ist in sich geschlossen, es gibt lediglich ein paar inhaltliche Anknüpfungspunkte. Wieder einmal entwirft Baxter ein Szenario, das etliche Jahrmillionen und ganze Galaxien umfaßt. Im Mittelpunkt stehen jedoch überschaubare Einzelschicksale auf einer durch Umweltkatastrophen heimgesuchten Erde der nahen Zukunft.
Michael Poole hat vor Jahren seine Frau Morag verloren, sieht jedoch immer wieder ihren Geist. Als sein Sohn beinahe bei der Explosion eines natürlichen Methanhydratlagers in Sibirien ums Leben kommt, erhält er von einer KI den Auftrag, die drohende Klimakatastrophe durch freiwerdende Hydrate zu verhindern. Poole ahnt nicht, daß er sein ganzes Leben lang von Alia, einer Frau aus der fernen Zukunft, beobachtet wird, die in der Gestalt Morags Kontakt aufnehmen will. Alia handelt im Auftrag der „Transzendenz“, einer Wesenheit, die sich aus menschlichem Bewußtsein entwickelt hat und kurz davor ist, alles Menschliche hinter sich zu lassen. Die Transzendenz hält es für notwendig, eine Wiedergutmachung für all das Leid zu finden, das Menschen im Lauf der Menschheitsgeschichte widerfahren ist. Als Alia sich am Ende Poole offenbart, wird klar, daß diese „Wiedergutmachung“ nur zu weiterem Unglück führen wird. Es gilt also, den Plan der Transzendenz zu vereiteln.
Baxter präsentiert in seinem neuen Roman, der sicher nicht zufällig Arthur C. Clarke gewidmet ist, die für ihn übliche Mischung aus naturwissenschaftlichen Fakten, Spekulationen und bombastischen Zukunftsvisionen. Diesmal versucht er dem Ganzen ein wenig Seele einzuhauchen, indem er eine rührende Liebesgeschichte und eine problematische Vater-Sohn-Beziehung ins Zentrum der dramatischen Ereignisse rückt. Dies gelingt allerdings nicht so gut, wie man es sich wünschen würde. Während Baxters grandiose Visionen ferner Welten und unbegreiflicher Wesen, die Zeit und Raum überwinden, immer noch faszinieren können, bleibt der menschliche Faktor auf Soap-Opera Niveau. Interessante Ideen gehen in der endlos breitgewalzten und manchmal etwas esoterischen Handlung verloren.
Fazit: routinierte Hard-SF mit Gefühlszulage.