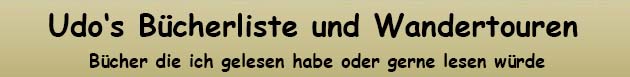Adler-Olsen, Jussi-Rezension

Morck 01 Erbarmen
Vizekriminalkommissar Carl Mørck steckt tief in einer Krise. Während der Überprüfung eines Tatorts wurden er und zwei seiner Kollegen Opfer eines brutalen Angriffs. Mørck kam zwar mit einem Streifschuss davon, seine Partner traf es um so heftiger. Anker starb an den Folgen der Schussverletzung und Hardy liegt querschnittsgelähmt im Krankenhaus. Zutiefst deprimiert bittet er Mørck sogar um Sterbehilfe.
Worauf sich dieser, obwohl mental angeschlagen, nicht einlässt. Stattdessen hadert er mit seinem Schicksal und nervt seine Umgebung. Wurde seine schroffe Persönlichkeit in der Vergangenheit durch sein Team und die erfolgreiche Arbeit abgemildert, ist der leidende Mørck seinen Vorgesetzten und Kollegen der Mordkommission jetzt ein Dorn im Auge. Leider zu populär, um ihn ohne weiteres herausreißen zu können. Also bedient man sich des umgekehrten Weges und befördert ihn.
In den Keller. Als Leiter des neu gegründeten Sonderdezernats Q soll er sich mit offenen, alten Fälle beschäftigen.
Zunächst kümmert sich Mørck um sein Wohlbefinden, denn das Dezernat Q wurde mit einem Millionenhaushalt versehen, der aber weitgehend an dem Chef ohne Untergebene vorbei, in andere Abteilungen fließt. Doch was für ein Druckmittel. Und so sieht sich Mørck bald ausgestattet mit gepflegtem Dienstwagen, Gerätschaften nach Wunsch und einem Assistenten namens Assad, der sich als findiger Mann für alle Fälle entpuppt. Und der erste spektakuläre Fall ist auch schnell gefunden: das nie geklärte Verschwinden der Merete Lynggaard.
Lynggaard, attraktive und aufstrebende Politikerin, verschwand fünf Jahre zuvor, nach einem Streit mit ihrem behinderten Bruder Uffe, von Bord einer Fähre. Ihre Leiche wurde nicht gefunden, Uffe zwar verdächtigt, aber nie angeklagt. Nachlässigkeiten während der ersten Ermittlung erregen das Interesse Carl Mørcks. Und so verbeißt er sich, gemeinsam mit seinem Adlatus Assad, in den Fall, findet Spuren, die vorher übersehen wurden und kommt so dem Schicksal der verschwundenen Abgeordneten immer weiter auf die Spur. Das sich als weit grauenerregender entpuppen wird, als jemals angenommen.
Jussi Adler-Olsen ist ein Filou. Schickt er den Leser doch mit Wonne und Wucht in ein typisch skandinavisches Szenario: traumatisierter, von seiner Frau verlassener, egomanischer Polizist findet neuen Lebensmut, während einer Ermittlung, die ihn wieder auf sich selbst zurück wirft. Doch gleichzeitig bricht er mit allen larmoyanten Begrenzungen, die in den Gefilden der Mitternachtssonne den gebeutelten Ermittlern triefende Augen verschaffen.
Denn Mørck ist nicht nur zweifelndes Opfer, sondern hartgesottener, arroganter Individualist, der die Welt nach seiner Pfeife tanzen lässt, und letztlich daran verzweifelt, dass er die Pfeife vorübergehend aus den Händen geben muss. Doch mit Assad zusammen wird er zum coolsten Duo, das Dänemark seit Pat und Patachon gesehen hat. Nach einer Phase der Lethargie, die Olsen genüsslich ausmalt, klären Mørck und sein Kompagnon nicht nur die Ereignisse um Merete Lynggaard, sondern leisten auch noch Hilfestellung bei aktuellen Fällen, die Mørcks zwischenzeitlich bröckelnde Position festigen. Trotz gelegentlicher Attacken einer übelmeinenden Presse.
Olsen lässt wahrlich nichts aus. Rätsel raten, Traumata, Psychopathen, alltäglicher Rassismus, sich selbst verwirklichende Frauen, Medienschelte und Rettung in höchster Not: er spielt mit Versatzstücken des Polizei- wie Psychothrillers, ein Jongleur, der mit einem halben Dutzend rotierender Kettensägen gleichzeitig arbeitet. Und dies mit Charme und Laissez-faire auch bewältigt.
Er bewegt sich derart gewandt auf dem schmalen Grat zwischen Parodie und hochgradiger Spannung, dass es eine wahre Lust ist. Die Episoden um die gefangene Merete Lynggaard und ihre Qualen haben die passende Länge, um nicht zu nervender Exploitation-Ware auszuarten. Mørck, seine berufliche Umgebung und Assad bewegen sich genau an jenem Rand des Wahnsinns, der mit einem Bein im Alltäglichen bleibt.
Und er kreiert dabei Figuren mit Wiedererkennungswert en masse. Sei es Vigga, die fidele Noch-Gattin Mørcks mit ihren hochtrabenden Plänen, und der Fähigkeit beständig zum falschen Zeitpunkt anzurufen, Jesper, der Heavy Metal liebende Sohn, der nur wenige Pinselstriche bekommt, die ihn aber als gleichwertigen Partner und freundlichen Skeptiker etablieren, oder Mørcks versponnenen Untermieter Morten, dessen Playmobil-Sammlung zur Lösung des Falles beiträgt und gleichzeitig für arge Gewitterwolken unter den Beteiligten sorgt.
Jussi Adler-Olsen ist ein facettenreicher Gewinner: Erbarmen ist gleichzeitig spannend, aberwitzig, nachdenklich, gut gelaunt, zu Tode betrübt, übertrieben, realitätsnah und voller surrealer Possen. Plus der spannenden Frage, ob das Level im nächsten Buch gehalten wird (in Dänemark wurde mittlerweile bereits der dritte Band um das Dezernat Q mit Erfolg veröffentlicht). Das Fundament ist gegossen …
Wenn Adler-Olsen sich von den Pilzen fernhält, die der Klappentextschreiber scheinbar genommen hat, der vollmundig verkündet: »Der Albtraum einer Frau. Ein dämonischer Psychothriller. Der erste Fall für Carl Mørck.«
Ja was denn nun? Kein Albtraum, sondern Realität. Keine Dämonen, sondern zutiefst verletzte Seelen. Kein Debütant, sondern ein erfahrener Ermittler in neuer Umgebung. Ansonsten stimmt alles.
Morck 02 Schändung
Elf Monate nach der Gründung des Sonderdezernats Q dürfen Vizekommissar Carl Mørck und sein Assistent Assad den zweiten Fall aus einer bewegten Vergangenheit auf Deutsch bearbeiten. Das Duo hat sich um die lautstarke, höchst aktive und ziemlich eigenwillige Bürokraft Rose verstärkt, die Mørck zunächst ziemlich nervt, aber wertvolle Unterstützung leistet. Die kann Mørck gut gebrauchen, denn obwohl der Erfolg des Dezernats Q im vorangegangenen Fall öffentlichkeitswirksam aufbereitet wurde, weht ein scharfer Gegenwind. Nicht ohne Grund, denn die Herrschaften, die im Focus der Ermittlung stehen, sind wohl angesehene Bürger mit Macht, Geld und Einfluss. Doch die Akten, die auf mysteriöse Weise auf Mørcks Schreibtisch auftauchen, lassen den Schluss zu, dass eine sechsköpfige Internatsclique in der Vergangenheit für mehrere Überfälle, Misshandlungen, Folter und Morde verantwortlich war. Aufhänger für die Ermittlung ist der brutale Totschlag an einem jungen Geschwisterpaar. Obwohl ein Mitglied der Clique sich zu der Tat bekannt hat und im Gefängnis sitzt, scheinen seine Freunde genauso schuldig zu sein.
Mehr als zwanzig Jahre nach dieser Tat – und dem Schulabschluss – treffen sich drei der Freunde immer noch zur Jagd – und gelegentlichen anderen Unternehmungen. Der ehemalige Kopf der Clique ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen, das einzige weibliche Mitglied ist untergetaucht. Und wird von den verbliebenen Drei verzweifelt gesucht, denn es scheint, dass der ehemalige Blickfang der Gruppe zum erbitterten Gegner geworden ist und Jagd auf die Jäger macht. Mørck und Assad versuchen die Frau namens Kimmie ausfindig zu machen und gleichzeitig ihre Komplizen zu überführen. Was umso gefährlicher wird, je mehr Belastungsmaterial sie finden.
Wohlsituierte Bürger, die sich über Recht und Gesetz hinwegsetzen, denen es Herkunft und Finanzen erlauben den eigenen Willen der Welt aufzuzwingen – kein neues Sujet. Vom Fall »Leopold und Loeb«, den Alfred Hitchcock als »Cocktail für eine Leiche« verfilmte, bis zu zahlreichen Derrick-Folgen, in denen arrogante Bürschchen aus Münchener Villenvierteln den überkorrekten und schlafmützigen deutschen Paradebeamten herausforderten: dieser Kampf um moralische Wertig- und Verantwortlichkeiten wurde vielfach ausgefochten und meist von den lauteren Gesetzesvertretern gewonnen.
Jetzt hat sich Jussi Adler-Olsen des Themas angenommen und schickt seinen eigensinnigen Ermittler – den vom deutschen Derrick Welten trennen – auf die Hatz nach dem Bösen, das sich stets selbst genügt. Während Stephan Derrick den drögen Systembewahrer darstellte, der die eitrigen Pickel am Po der bundesdeutschen Gesellschaft ausdrückte; rückt Adler-Olsen das Bild in eine gänzlich andere Richtung. Etwas holzschnittartig, aber mit aller Konsequenz: Ditlev Pram, Ulrik Dybbøl Jensen und Torsten Florin stehen stellvertretend für eine Gesellschaftsform, in der Missbrauch und Vernichtung nach Lust und Laune praktiziert werden. Warum? Weil es möglich ist …
Denn die Jungs und späteren Männer haben Möglichkeiten, sich Schweigen zu erkaufen und sind gleichzeitig geschickt genug, das ein und andere Mal nahezu unsichtbar zu bleiben. Bis sich die eingesetzte Gewalt gegen sich selbst richtet und aus der anbetungswürdigen (und möglicherweise gnadenlosen Killerin) Kimmie ein schmerzerfüllter Racheengel wird, dessen Lebenssinn nur noch in der Vernichtung der eigenen Vergangenheit besteht.
Als Antipode ist Carl Mørck die beste Besetzung. Der Rebell, der sich von klein auf gegen Autoritäten auflehnte. Ihm etwas zu verbieten, sei der beste Grund ihn zu ausgeprägten Aktivitäten anzustacheln, wird mehrfach betont. Dass er mit Assad und Rose zwei ebenso aufrührerische, wenn auch anders geartete, kleine Geschwisterchen besitzt, macht das Team nicht gerade leicht berechen- und ausschaltbar. Gut für uns.
Wenn ein gewisser »Herbert« in einem Leserkommentar zu Erbarmen schreibt: »Etwas nervig, dass auch dieser Kommissar sich in die Reihe traumatisierter oder ausgebrannter, alkohol- oder sonstig –abhängiger, geschiedener oder zumindest problembehafteter Beziehungen belasteter, zerrissene , grüblerische bis depressive Charaktere skandinavischer Ermittler einreiht. Gibt’s da oben keine halbwegs normalen Kripobeamten?«, hat er etwas grundlegendes nicht verstanden. Carl Mørck ist kein ausgebrannter, zerrissener Charakter. Er wird durch seine Arbeit und seine Mitmenschen mit Problemen konfrontiert, denen er sich immer, manchmal augenrollend und widerwillig, stellt. So ist ein Hauptgrund seine Psychotherapeutin zu sehen, auch der, dass er mit ihr liebend gerne ins Bett steigen würde. Dass es – bislang – nicht geklappt hat, und Mørck in entscheidenden Momenten ernsthafte Gespräche mit Mona Ibsen sucht, zeigt doch jene »Normalität«, die sich Herbert so sehnlich wünscht. Mehr braucht es nicht …
Diesmal dauert es etwas, bis das Dezernat Q ins Zentrum der Erzählung rückt. Zu Beginn wird der obdachlosen Kimmie viel Raum zugestanden, mehr sogar als ihren Ex-Freunden, die sich gerne noch wie die Axt im Walde benehmen. Das ist mitunter etwas klischeehaft und leicht gelangweilt verfasst (Kimmies Straßenleben, Torsten Florin und seine Jagdsklaven, Ditlev Prahms philippinische Hilfsarbeiterinnen, die er im Vorübergehen missbraucht), als würde Adler-Olsen eine Liste abhaken. Glücklicherweise fängt er sich ziemlich schnell wieder, und je weiter die Handlung voran schreitet, um so nachvollziehbarer werden Denkungsart und Aktionen seiner Protagonisten (und vor allem der Protagonistin Kimmie). Wenn auch Übertreibung eines seiner Lieblings-Stilmittel bleibt. Immerhin ist Adler-Olsen auch darin konsequent bis zum Schluss.
Abzüge gibt es für den Showdown, dessen dramaturgische Mittel seiner Entstehung zu dicht am Erstling angesiedelt sind. Aber es knallt ordentlich und eine gewisse Befriedigung niederer Gelüste kann man dem Ende nicht absprechen. Jussi Adler-Olsen weiß, wie man seine Leser da packt, wo es wehtut.
Während Sohn Jesper, Mitbewohner Morten und aufgeregte Ex-Frau Vigga diesmal ein bisschen kurz wegkommen, zeigt sich in kurzen Randbemerkungen zu Assad und in den Gesprächen Carl Mørcks mit seinem querschnittsgelähmten Freund und Ex-Kollegen Hardy, dass bereits einiges an zukünftiger Beschäftigung auf das Dezernat Q wartet. Wir freuen uns drauf.
Dass Jussi Adler-Olsen hierzulande mit Macht in die Rolle eines Stieg Larsson-Nachfolgers gedrückt werden soll, stimmt etwas betrüblich. Denn der dänische Autor hat eine eigene Stimme, eigene Themen und Betrachtungsweisen, die eine Fahrt im Windschatten des erfolgreichen schwedischen Kollegen völlig überflüssig erscheinen lassen. Aber marketingstrategisch ließ es sich wohl nicht vermeiden: nach Verblendung kommt die Schändung, nach Vergebung die Erlösung (wird gemunkelt). Nächstes Jahr.
Dabei besitzt der aktuelle Roman mit »Fasanenmörder« (Fasandræberne sinngemäß übersetzt) einen einprägsamen und originellen Titel, den man nicht hätte zu schänden brauchen. Ändert glücklicherweise nichts am Inhalt, der gelungene, spannende Unterhaltung mit Widerhaken bietet.
Morck 03 Erlösung
Wir können es kurz machen: Flaschenpost von P. aka Erlösung, der dritte Roman um Carl Mørck und das Sonderdezernat Q, ist der beste der bisher auf Deutsch erschienenen Bände.
Obwohl die Geschichte kaum originell erscheint – in seiner Kindheit traumatisierter Soziopath entführt Kinder, erpresst die Eltern und tötet einen Teil seiner Opfer – überzeugt das Buch in fast allen Belangen.
Jussi Adler-Olsen gesteht dem Mann ohne Namen, der sich selbst »Chaplin« nennt, viel Raum ein. Er erzählt eine Familiengeschichte innerhalb derer ein misshandeltes Opfer langsam zum Täter mutiert. Die Grenzen sind, wie so oft, fließend, und die Entwicklung, die Chaplin nimmt, keineswegs zwangsläufig. Er ist ein kluger Kopf, dem von klein auf eingebläut wurde wie geschlossene, religiös orientierte Gemeinschaften funktionieren. Als Erwachsener macht er sich dieses Wissen auf perfideste Weise zu Nutzen. Sein auf Erpressung und Mord basierendes System funktioniert, da die jeweiligen Mitglieder der Gemeinden, die Chaplin infiltriert, genau auf diese äußeren Reize reagieren. Sie sind es nicht anderes gewohnt.
Jussi Adler-Olsen ist kein besonders filigraner Autor, aber ein höchst kraftvoller. Erlösung macht keinen Hehl daraus, dass in repressiven, von fatalistischem Glauben geprägten Strukturen, genau diese Erlösung nie eintreten wird. Fanatismus, Unterdrückung, mangelnde Kommunikationsfähigkeit machen es Menschen wie Chaplin erst möglich, ihre Mischung aus Obsession und Kalkül auszuleben. Dabei ist Chaplin kein überragendes Genie des Bösen, sondern lediglich ein Kontrollfreak, der seine Lektionen gelernt hat. Der in einer Welt des Leidens aufgewachsen ist und genau dieses Leiden zurückbringt in die Welt. Der sich keine Gedanken um Mitleid, Liebe und Schmerz macht, sondern sein Umfeld nur aus einer Sicht betrachtet: wie ziehe ich meinen größtmöglichen individuellen Nutzen daraus?
Eine so schlichte wie essenzielle Frage, bei deren Beantwortung klar sein sollte, dass sie über das Sujet eines auf Spannung optimierten Romans hinausreicht. Denn ganz egal, in welchem Umfeld man sich bewegt, wer die Mechanismen eines Systems durchschaut hat, und ohne Rücksicht auf (menschliche) Verluste agiert, wird sich selbst bereichern können und gilt, solange er den Rahmen gesellschaftlicher Konventionen nicht allzu offensichtlich verlässt, als erfolgreicher Unternehmer. Chaplin hat diesen Rahmen seit langem gesprengt und kommt trotzdem damit durch. Bis er auf Menschen trifft, die bereit sind sich zu öffnen. Aus Angst, Sorge oder als Ergebnis einer bewusst getroffenen Entscheidung, endlich ein Risiko einzugehen. Das wird zwar nicht für gerechte Verhältnisse sorgen, aber eine Chance sein, aus einem abgeschotteten System, das Unwissenheit als wahren Weg zum Glück propagiert, auszubrechen.
Auch hier ist Adler Olsen klug genug, nicht einfache Rezepte wie Rache und Genugtuung als Lösung anzubieten. Wenn der Roman seinem Ende entgegen taumelt, wird es fast nur Verlierer geben. Lediglich eine Geste der Versöhnung bleibt als Hoffnungsschimmer.
So viel zum Verbrechen. Welches der Autor in einem Gespinst aus Unterdrückung, Fanatismus und ignoranter Weltvergessenheit verortet. Adler-Olsen verschweigt natürlich nicht, dass es für all diese Verhaltens- und Denkweisen Gründe gibt. Das hebt ihn ebenfalls aus der Masse der wir-geben-ihrem-Spannungsorgasmus-ein-Zuhause-orientierten Autoren. Die Opfer spielen dem Täter zwar in die Hand, lassen es zu, dass er sie und ihr Leben beherrscht, selbst lange Zeit nachdem das Verbrechen verübt wurde. Aber sie werden nie zu Handlangern einer allzu publikumsgefälligen Spannungsdramaturgie. Sie bleiben glaubwürdiges Produkt ihrer von außen produzierten, aber aus der Sehnsucht nach innerer Sicherheit geborenen Unmündigkeit.
Bleiben unsere Ermittler. Hier setzt Adler-Olsen seinen Weg konsequent fort. Vielleicht ein wenig zu konsequent. Carl Mørck und Assad sind endgültig zu den erfolgreich Verbrechen bekämpfenden Pat Und Patachon ihrer Generation geworden. Jussi Adler-Olsen entwickelt die Geschichte seiner Protagonisten weiter, ohne dass es aufgesetzt wirkt; er baut Geheimnisse, Macken und Neurosen ein, erlaubt sich den Luxus manches nicht aufzulösen und sorgt immer wieder durch knappe, sarkastische Scherze für Bodenhaftung. Gleichzeitig bringt er mit dem seltsamen Paar Rose/Yrsa einen fast surrealistischen Zug umgeben von einem Hauch alltäglichen Wahnsinns ins Spiel; bleibt auch hier süffisant im Vagen, indem er – ganz skandinavisch – seine Figuren manche Themen nicht ansprechen lässt. Aber sie stehen im Raum und werden diesen in Zukunft garantiert beanspruchen.
Stichwort Finale: Mir wäre es ganz lieb, beim nächsten Roman gäbe es eine Alternative zum Verlauf des Showdowns, der jetzt bereits zum dritten Mal auf ähnliche Weise stattfindet. Der desillusionierende Schlussakt ist immanent durchaus glaubwürdig, aber in seiner Entwicklungsstruktur nicht weit von Erbarmen und Schändung entfernt. So kann man sich entweder an der Beständigkeit des Autors erfreuen, oder für´s nächste Buch eine Variante herbeiwünschen.
Positiv anzumerken ist, dass zum ersten Mal der deutsche Titel – trotz Stieg-Larsson-ick-hör-dir-trapsen-Attitüde – seine Berechtigung hat. Wenn auch auf eine höchst bissig kommentierende Art – was die Verantwortlichen vermutlich wohlmeinend eingeplant haben…
PS.: Erlösung ist ein Buch mit Bonus. Nennt sich volltönend »Augmented Reality«, ist aber nichts anderes als das Äquivalent zu einem Audiokommentar, wie man ihn geflissentlich als Zusatz bei DVDs findet. Wer sich unter der im Buch angegebenen Internetadresse einloggt, bekommt einige amüsante Zusatzinformationen von Jussi Adler-Olsen zu den Handlungsorten geliefert. Passt schon.
Morck 04 Verachtung
Nach einem nicht so gelungenen Intermezzo, das uns zu Adler-Olsens Debütroman Das Alphabethaus aus dem Jahre 1997 führte, geht’s jetzt weiter mit frischem Stoff aus der Carl-Mørck-Reihe, die den Autor weltweit bekannt gemacht hat. Die Erwartungen an das Ende letzten Monats erschienene Verachtung waren groß, hatte der Autor selbst mit den drei Vorgängern die Messlatte sehr hoch gelegt. Herausgekommen ist ein weiterer solider Kriminalroman, der sich auch gleich in den Spitzenpositionen der diversen Büchercharts einnistete, auch wenn die Fans wegen des Hardcover-Formats diesmal tiefer in die Tasche greifen mussten. Die Werbe-Maschinerie rattert und die semiprofessionellen Cheerleaders des größten deutschen Online-Anbieters strecken eifrig ihre 5-Sterne-Pompons in die Höhe. Anderswo hält sich die Begeisterung eher in Grenzen. Jussi Adler-Olsen hat auch Glück. Sein Werk ist zur Zeit zwar nicht alternativlos, aber konkurrenzlos. Nicht, dass es auf dem Büchermarkt nicht qualitativ Höherwertiges gäbe, aber wir wissen ja, dass sich dieses nicht unbedingt gut verkauft. Wer momentan fehlt, das sind die Abräumer der letzten Jahre wie Cody McFadyen oder Simon Beckett. Ob sie an Schreibblockade leiden oder an Ideenlosigkeit – wir wissen es nicht. Nur die »Grande Dame« der Kriminalliteratur ist mit ihrem neusten Œuvre Glaube der Lüge auf der Piste, das sich leider als ein Grabgesang auf den Kriminalroman entpuppt.
Jussi Adler-Olsen hat auf jeden Fall seine Pflicht getan, seine Hausaufgaben gemacht, um es mal mit den Lieblingsworten der Bundeskanzlerin auszudrücken. Für solide, aber nicht herausragende Leistungen gab es früher in der Schule eine Drei plus oder wohlwollend eine Zwei minus. In diesem Bereich liegt auch die Einschätzung des Rezensenten. Ausgestattet mit einem bewährt pointierten Titel und dem Abbild der traditionellen, der sogenannten »Blutschere«, die seit Jahren wie eine Olympische Flamme von Verlag zu Verlage getragen wird, wird die deutsche Ausgabe der Erfolgsgeschichte von Carl Mørck und seinem Sonderdezernat Q seinen Weg weiter fortsetzen.
Carls Mini-Team, bestehend aus ihm und seinen Assistenten Rose und Assad, hat sich jetzt in Folge 4 als eingespielte Truppe etabliert und ist seinem Schöpfer zu einem Pfund geworden, mit dem dieser nun trefflich wuchern will. Von Folge zu Folge gab und gibt Adler-Olsen mehr Informationen über seine Protagonisten preis, ohne aber ihre letzten Geheimnisse zu offenbaren. So können wir weiterhin über Assads undurchsichtigen Hintergrund rätseln oder uns über Roses leicht dissoziative Anwandlungen wundern. Es macht einfach Spaß, ihnen bei der Arbeit über die Schultern zu schauen und ihrer locker frotzelnden Konversation zu folgen. Adler-Olsen legt ihnen so manches Bonmot in den Mund. Leider ist auch er nicht vor Ausrutschern gefeit. Die Diskussionen um die spritzerfreie Nutzung einer Toilette ist ein Griff in die Selbige. Peinlich.
Ansonsten ist das Sonderdezernat recht guter Dinge und wühlt eifrig in den alten Akten. Dabei stoßen sie auf das spurlose Verschwinden eines »Leichten Mädchens« im Jahre 1987. Eine erweiterte Computerrecherche bringt die Erkenntnis, dass in einem kurzen Zeitraum des Jahres mehrere Personen als vermisst gemeldet wurden.
Während Carls Team der Sache auf den Grund geht, rollt Jussi Adler-Olsen in Rückblicken das Leben einer gewissen Nete Hermansen auf. Geboren Ende der 1930er Jahre musste sie von Kindesbeinen an auf dem elterlichen Bauernhof tatkräftig mitwirken. Der Schulbesuch war sporadisch, ihr Lese- und Schreibvermögen blieb deswegen unterentwickelt. Nach dem frühen Tod der Mutter war der Vater als Alleinerziehender überfordert. In ihren Teenie-Jahren geriet Nete unverschuldet auf die schiefe Bahn. Nach zwei Abtreibungen wird dem Vater das Sorgerecht entzogen. Netes langsamer, aber stetiger Abstieg führt über mehrere Pflegefamilien, bis sie in einer Anstalt für sozialhygienisch aussortierte Frauen auf Sprogø, einem gottverlassenen Eiland im Großen Belt, landet. Die Zeit dort wird ihr als Vorhof der Hölle in Erinnerung bleiben. Später wendet sich ihr Schicksal. Es geht ihr gut, bis sie im Jahre 1987 auf einen ihrer früheren Peiniger trifft.
Es ist wirklich keine Überraschung, dass diese beiden Handlungsstränge miteinander in Verbindung stehen. Dem Leser ist schon relativ früh klar, wie der Hase laufen wird. Dafür sorgen die bruchstückhaften Erinnerungen von Netes Wegbegleitern – nur wer, wieweit involviert ist, bleibt ein Geheimnis. Während seiner Ermittlungen stößt das Q-Team nämlich ganz unerwartet auf den Frauenarzt Curt Wad, der nach dem 2. Weltkrieg nicht nur die Praxis seines Vaters übernahm, sondern auch dessen braune Gesinnung. Wie die sprichwörtlichen Halbgötter in Weiß maßen er und eine Handvoll Kollegen sich an, Herren über Leben und Tod zu spielen. Ihr innerer Zirkel nennt sich »Geheimer Kampf« und führt einen Untergrund-Krieg gegen nach ihren Ansicht unwerten Lebens. Nach außen hin treten sie als rechtspopulistische Partei (in Gründung) auf, deren Name »Klare Grenzen« auf einen weiteren Punkt ihres Parteiprogramms hindeutet – gegen die Überfremdung ihres kleinen Königreiches
Jussi Adler-Olsen hat sich diesmal nicht auf eine rein fiktive Erzählung beschränkt, sondern sich eines der dunklen Kapitel der dänischen Vergangenheit angenommen. Wie er in einem Nachwort noch einmal betont, hat es diese Anstalt auf Sprogø von 1923 bis 1961 wirklich gegeben und in diesen Zeitraum fallen auch etwa 10 000 Sterilisationen, die meist unter Zwang durchgeführt wurden. Adler-Olsen kritisiert, dass den betroffenen (meist) Frauen bis heute noch keine Anerkennung seitens des dänischen Staates erfolgt ist. Es ist eine Stärke seines Romans, dass es dem Autor gelingt, seine eigene Betroffenheit über die damaligen Zustände auf den Leser zu übertragen. Das Leiden der Nete Hermansen lässt niemanden kalt
Die Figur der Nete und ihr Lebensweg sind es auch, die Adler-Olsens Plot vor einem Absturz bewahren. Sein Konzept eines (fast) allwissenden Lesers nimmt der Handlung viel an Suspense. Zu vorhersehbar ist die Entwicklung und die Überraschungseffekte am Ende der Story erzeugen beim Leser nur ein müdes Lächeln. An sich ist es ja spannend, die Ermittler zu beobachten, wie sie sich langsam dem Täter nähern oder sich auf Irrwege begeben, doch das Sonderdezernat Q ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das lenkt nicht nur ab, sondern verhindert auch, dass durch eine aktive Ermittlung Dynamik entsteht
Der Deutsche Taschenbuch Verlag (dtv) möchte Verachtung gerne als Thriller verkaufen, dabei ist es fast frei von Thriller-Elementen. Es ist ein Kriminalroman der ruhigeren Art und das liegt vermutlich voll in der Absicht des Autors. Adler-Olsen konzentriert sich auf sein bestens eingeführtes Team und auf einen alten, auf den ersten Blick harmlosen Fall, der intensiv mit dem Schicksal einer Person verbunden ist, die ihrerseits gleichsam Mosaik- und Stolperstein einer nationalen Verschwörung ist.
Die einzelnen Handlungsstränge sind geschickt miteinander verwoben. Perspektivwechsel in Raum und Zeit ersetzen in etwa die Spannung, die durch die Durchschaubarkeit des Plots verloren geht. Das Interesse, den Fall weiter zu verfolgen, bleibt geweckt.
Für den Rezensenten spielt Jussi Adler-Olsen in der selben Liga wie sein norwegischer Kollege Jo Nesbø, dessen Harry-Hole-Reihe ja auch von Licht und Schatten geprägt ist. Es gibt herausragende, gute und weniger gelungene Folgen. Nicht anders ist es bei Adler-Olsens Carl-Mørck-Reihe, wenn man das nach vier Folgen schon so sagen kann. Verachtung ist bisher sein schwächster Roman, der aber gemessen an den populären Topsellern, die üblicherweise die Spitzenplätze der Büchercharts bevölkern, immer noch für versiertes Handwerk steht. Es ist erfreulich, dass dem Dänen die Aufmerksamkeit gezollt wird, die seine Romane verdienen, die Romanen dieser Qualität nur zu selten zuteil wird. Aber es gibt keinen Grund, darüber in Verzückung zu geraten. Die Carl-Mørck-Reihe ist solide Kriminalliteratur – nicht mehr, nicht weniger.
Morck 05 Erwartung
Dänische Banker werden von der Finanzkrise gebeutelt und vergehen sich an den Ärmsten der Armen. In Kamerun wird der afrikanische Koordinator eines dänischen Hilfsprojektes gemeuchelt. Ein hoher Beamter des dänischen Außenministeriums verschwindet nach seiner Rückkehr von einer Inspektionsreise spurlos. Ein fünfzehnjähriger Junge will seinen kriminellen Familienclan verlassen und stolpert über eine Leiche. Das Sonderdezernat Q mit Carl, Rose und Assad ist gut drauf und löst einen Fall in Windeseile. Gleichzeitig müssen sie sich aber mit einem neuen Chef und einem unliebsamen Hospitanten herumschlagen. Durch Zufall wird Rose auf einen Fall gestoßen, der schon länger auf den Schreibtischen des Sonderdezernats ruht, der die Grundlage für Erwartung bildet.
Man kann nun nicht behaupten, Jussi Adler-Olsen gingen die Ideen aus. Auch die fünfte Folge der Carl-Mørck-Reihe wartet mit einem vielschichtigen Plot auf. Der Autor spannt geographisch einen Bogen über mehrere Kontinente. Erwartung beginnt im Herzen Afrikas, spielt hauptsächlich in Kopenhagen und dem Umland und endet irgendwo in Südamerika. Kriminalistisch reicht das Spektrum vom simplen Taschendiebstahl bis zu brutalen Auftragsmorden. Das könnte jetzt vor Spannung nur so knistern, tut es leider nicht. Adler-Olsen bleibt bei seiner Strategie des offenliegenden Plots. Der Leser wird vorab über alles informiert, diesmal gibt es weder Geheimnisse noch Überraschungen, wenn man mal vom Ende der Story absieht. Natürlich kann auch ein solches Konzept Spannung in sich bergen, wenn z.B. die Ermittler sich nahe am Täter befinden, dieser aber immer entwischt, oder wenn man die Ermittler auf einer falschen Fährte beobachtet. Und noch einmal Fehlanzeige. Adler-Olsen konzentriert sich auf das Innenleben seines Q-Teams und widmet sich in aller Ausführlichkeit dem Schicksal eines Jugendlichen, der unbarmherzig von seiner »Familie« gejagt wird.
Der Marco-Effekt
Der Untertitel von Erwartung lautet »Der Marco-Effekt« – abgeleitet vom Titel des dänischen Originals. Darunter stellt sich Jussi Adler-Olsen so etwas wie den berühmten Schmetterlings-Effekt vor, nur halt auf kürzere Distanz und direkt wirkend.
Der fünfzehnjährige Marco ist Mitglied einer Bande Kleinkrimineller, die sich mit professioneller Bettelei, Taschendiebstahl und Trickbetrügereien über Wasser hält. Er sieht sie als seine Familie an, schließlich gehören sein Vater und sein Onkel auch dazu. Aber ein richtiger Familien-Clan sind sie doch nicht, eher ein Haufen Gestrandeter aus verschiedenen Nationen, die eine etwas dunklere Hautfarbe kennzeichnet. (Adler-Olsen laviert da ziemlich herum. Erst bringt er ohne Notwendigkeit die Bezeichnung »Zigeuner« ins Spiel, um das dann, der »political correctness« gezollt, ständig zu relativieren. Sehr ungeschickt gemacht, Herr Autor!)
Auf jeden Fall ergreift Marco, als er mitkriegt, dass der »Boss« ihn vorsätzlich zum Krüppel machen will, um noch bessere Ergebnisse beim Betteln zu erzielen, unverzüglich die Flucht. Nachts allein im Wald, die Häscher im Nacken, verbuddelt er sich im weichen Waldboden und bleibt unentdeckt. Unglücklicherweise hat er sich genau eine Stelle ausgesucht, an der schon eine Leiche notdürftig vergraben liegt. Marco ahnt, dass seine Sippschaft etwas damit zu tun haben könnte.
Das Auffinden der Leiche löst einen Dominoeffekt aus. Nicht nur Marcos Clan ist durch dessen Wissen gefährdet, sondern auch eine Reihe hochstehender Persönlichkeiten, deren Komplott aufzufliegen droht. Marco taucht in Kopenhagen unter. Er will seine kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen, nicht nur weil er jetzt im Visier mehrerer Banden steht, sondern auch weil er schon länger nicht mehr die entsetzten Gesichter der Opfer, die er betrogen und beraubt hat, ertragen kann. Er möchte zu den »Guten« gehören, möchte zur Schule gehen, lernen, studieren – ein anderes »normales« Leben führen. Doch seine Verfolger lassen ihn nicht zur Ruhe kommen. Sein jetziges Leben ist eine permanente Flucht
Nette Unterhaltung
Wenn man die Kriminalliteratur der letzten zwei Jahrzehnte Revue passieren lässt, kann man feststellen, dass sich – ähnlich wie im Fernsehen – markante Hauptprotagonisten als Erfolgsgaranten etabliert haben, was sich sowohl in ihrer Beliebtheit bei der Leserschaft als auch ganz konkret in besten Verkaufszahlen widerspiegelt. Es ist müßig, all die vielen Lynleys, Scarpettas oder Kluftis aufzuführen. Jussi Adler-Olsen hat mit Carl-Mørck, Rose und Assad aus dem Sonderdezernat Q Kultfiguren geschaffen. Waren sie in den ersten Folgen der Reihe noch nicht so richtig greifbar, haben sie bis zur vorliegenden Folge 5 deutlich schärfere Konturen angenommen und ihre privaten und dienstlichen Interaktionen nehmen einen breiteren Raum ein. Es ist Geschmackssache, ob man von ihren kalauernden Gesprächen und Gedanken begeistert ist oder sie für entbehrlich hält. Dem Rezensenten kommt die Fallanalyse und die Aufklärung als Herzstück eines Kriminalromans einfach zu kurz. Da stimmt die Gewichtung nicht mehr. Ein Quickie auf dem Dienstschreibtisch oder das permanente Einstreuen von Kamel-Witzen erhöhen zwar den Unterhaltungswert, schmälern aber gleichzeitig das Wesentliche eines Krimis: die Spannung.
Wenig Spannung
Das Ausgangsverbrechen wird von verzweifelten Bankern initiiert. Ob ihr Problemlösungsweg der Wirklichkeit standhält, darf bezweifelt werden. Aber seit »Alphabethaus« und »Washington-Dekret« wissen wir, dass Jussi Adler-Olsen mit eigenen Realitäten arbeitet. Im konkreten Fall ist es nicht so entscheidend. Schwerer wiegt, dass es Adler-Olsen wieder misslingt, mit einem guten Plot Spannung zu erzeugen. Was ist eine Verschwörung ohne geheime Drahtzieher, wenn alle Rollen verteilt sind und offen benannt werden?
Auch der Marco-Handlungsstrang birgt eher wenig Spannung. Obwohl Marcos (Dauer-)Flucht für die nötige Action sorgt, ist sie im Grunde genommen eine rührende Herzschmerz-Geschichte mit absehbarem Ausgang. Die Wandlung eines jugendlichen Saulus zum Paulus kann aus moralischen Gründen nicht schlecht ausgehen.
Eine »Ende gut, alles gut«-Geschichte. Mainstream für den amerikanischen Markt, auf dem Jussi Adler-Olsen mittlerweile gut Fuß gefasst hat. Eine bange Frage bleibt für die Fortsetzung: Wendet sich Carl Mørck seiner alten gescheiterten oder seiner neuen scheiternden Beziehung zu?
Nein, die bange Frage lautet: Macht Jussi Adler-Olsen auf diesem bescheidenen Niveau weiter? Oder kriegt er noch mal die Kurve?
Das Washington-Dekret
»Atemraubend spannend! – Faszinierend! – Realistisch!«
»Konstruiert! – Unglaubwürdig! – An den Haaren herbeigezogen!«
Jussi Adler-Olsens Roman Washington dekretet aus dem Jahre 2006, jetzt im Zuge des Adler-Olson-Hypes hierzulande auch auf Deutsch veröffentlicht, spaltet die Leserschaft. Das Spektrum der Reaktionen reicht von großer Begeisterung bis hin zur totalen Ablehnung.Warum der Roman so ein widersprüchliches Echo hervorruft, liegt hauptsächlich daran, dass der Autor gemessen an der Realität ein unglaubwürdiges Szenario entwirft – ein US-amerikanischer Präsident stürzt per Dekret sein Land in ein bürgerkriegsähnliches Chaos. Damit aber nicht genug, auch später stolpert man über etliche Ungereimtheiten, Auslassungen,Verallgemeinerungen und krasse Übertreibungen.
Dekrete – im US-amerikanischen Hoheitsgebiet »Executive Orders« genannt – sind Teil des präsidialen Machtinstrumentariums und gehen in den USA bis ins 18. Jahrhundert zurück. In der Regel werden präsidiale Gesetzesinitiativen und Verordnungen durch ein Votum des amerikanischen Kongresses (Repräsentantenhaus und Senat) gestützt oder verworfen.
Nach den Ereignissen von 9/11, die die Politiker des Landes an den Rand einer Paranoia brachten, sind in der Tat einige umstrittene »Executive Orders« erlassen worden, auf die sich Adler-Olsen in seinem Roman bezieht, wie er im Nachwort schreibt. Ebendort ist aber auch, quasi als Warnhinweis für den Leser, festgehalten:
Der vorliegende Roman ist ein fiktionales Werk. Alle Figuren und Ereignisse sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen und realen Ereignissen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Dass Jussi Adler-Olsen mit der Realität nicht viel im Sinn hat, merkt man schon gleich in der Eingangssequenz zum Haupthandlungsstrang, denn er stellt den folgenschweren Maßnahmenkatalog (Washington-Dekrete) als reinen Willkürakt einer zutiefst verstörten Person dar.Was war passiert?
In der Wahlnacht, in der der frisch gewählte, neue amerikanische Präsident Bruce Jansen seinen erdrutschartigen Wahlsieg in einem Luxushotel in Virginia gebührend feiern will, wird dessen hochschwangere 2. Frau von einem Hotelangestellten erschossen. Das Fatale ist, dass Jansens 1.Frau ein ähnliches Schicksal erleiden musste. Vor sechzehn Jahren, als Jansen noch einfacher Gouverneur von Virginia war, begleitete er mit seiner Frau und seinen engsten Mitarbeitern die Gewinner eines TV-Ratespiels auf ihrem Trip durch China. Bei einer Besichtigung wurde Jansens Frau vor seinen Augen bei einem fehlgeschlagenen Straßenraub mit einem Messer tödlich verletzt. Wie gut oder wie schlecht Jansen dieses Trauma verarbeitet, ist nicht bekannt. Als sich nun dieses schreckliche Ereignis wiederholt, zieht er sich von allen Weggefährten und Freunden zurück und schmiedet düstere Pläne, wie die Öffentlichkeit bald erfahren wird. Den Amtseid noch auf den Lippen, verkündet er ein ganzes Bündel von Dekreten, die in ihrer Gesamtheit und Widersprüchlichkeit unsinniger nicht sein könnten. Erleichterungen beim Abhören von Wohnraum und Telekommunikation, Einschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit, Verbot des Verkaufs und des Besitzes von Munition, Rückruf aller im Ausland stationierten Soldaten und Freilassung aller (mit Ausnahme der zum todeverurteilten) Strafgefangenen. Starker Tobak für Politiker, welcher Couleur auch immer, und für die Führungsetagen von Handel, Banken und Industrie. Man könnte annehmen, dass sie mit allen Mitteln dagegen sturmlaufen, aber der Autor verwehrt ihnen den Widerstand. Nur das Volk versammelt sich zu gelegentlichen Demonstrationen. Allein einige militante Hinterwälder gehen kompromisslos zur Sache, weil sie fürchten, dass ihnen die Patronen ausgehen könnten.
Es ist schon ein seltsames Szenario, das Adler-Olsen hier entwirft, zumal das Attentat offiziell nur auf zwei Personen zurückgeführt werden kann. Der Täter, der etwas minderbemittelte Hotelangestellte, wird auf frischer Tat erschossen. Als Anstifter muss der millionenschwere Hotelbesitzer Bud Curtis herhalten. Dass ihm etwas untergeschoben wird, merkt der Leser sofort, leider aber nicht seine überbezahlten Anwälte. Ratzfatz sitzt Curtis in der Todeszelle. Dabei braucht später ein einfacher Sheriff gerade mal ein paar Stunden Akteneinsicht, um die Lücken in der Beweisführung zu finden.
Jussi Adler-Olsen erzählt seine Geschichte aus der Sicht mehrerer Personen, die sich zum Teil schon auf der Chinareise vor 16 Jahren kennengelernt hatten. Als Erste ist da Dorothy Rogers zu nennen. Sie belegte damals als 14-Jährige den 3. Platz beim Fernsehquiz und seit der Chinareise fühlt sie sich dem ehemaligen Gouverneur und jetzigen Präsidenten freundschaftlich verbunden. Nach ihrem Jurastudium stieg sie in dessen Wahlkampfteam ein und arbeitet jetzt an untergeordneter Stelle im Weißen Haus. Dorothy – von allen, warum auch immer, Doggie genannt – ist fatalerweise die Tochter des inhaftierten Hoteliers Bud Curtis (sie trägt den Nachnamen ihrer Mutter, der zum Glück nicht Style lautet). Auch wenn das Verhältnis zu ihrem Vater wegen dessen kontroversen politischen Ansichten nicht das beste war, entwickelt sie doch noch Gefühle für ihren alten Herrn in seiner aussichtslosen Situation. Sie nimmt Kontakt zu Sheriff T. Perkins auf, auch ein Quiz-Gewinner, der im ländlichen Virginia eine ruhige Kugel schiebt. Dieser lässt seine Beziehungen spielen und kann auch schnell vielversprechende Resultate aufweisen. Ansonsten sieht es mau aus mit Dorothys Freunden. Im Weißen Haus sitzt noch Wesley Barefoot, der Pressesprecher des Präsidenten, der aber ein unsicherer Kantonist zu sein scheint, da er doch arg auf seine Karriere bedacht ist. Seine sporadischen Gefühlsanwandlungen Dorothy gegenüber wirken ziemlich aufgesetzt. Aber in Zeiten der Not muss jeder erst einmal sehen, wo er bleibt, oder auch nicht.
Die USA im Ausnahmezustand. Die USA als Kontroll- und Überwachungsstaat. Wie so etwas in der Realität aussehen könnte, kann man sich einerseits nicht vorstellen, andrerseits kann man seiner Fantasie freien Raum lassen. Das haben besonders im letzten Jahrzehnt viele Future-Fiction-Autoren getan, deren meist dystopische Gesellschaften auf einer Mischung aus Faktischem, Wahrscheinlichem und Möglichem gründen. Jussi Adler-Olsens Absicht war, sich in seinem Washington-Dekret möglichst nahe an der Realität zu orientieren. Wenn man das macht, muss sich auch firm machen, wie die Realität denn aussieht. Dazu bedarf es eines Blickes hinter die Kulissen. Wie viele überschätzt auch Adler-Olsen die Macht eines amerikanischen Präsidenten. Es ist völliger Humbug zu glauben, er könne im Alleingang weitreichende Dekrete, wie beschrieben, durchsetzen. Genauso abwegig ist die sich daran anschließende Verschwörung, die auf die Machtgier eines einzelnen Politikers zurückzuführen sei. Es wird in den USA mächtige Strippenzieher geben, aber die sind nicht in der Politik zu finden.
Der Rezensent kann sich der Buchhändlerin Uli, die den ersten Leserkommentar hier auf der Krimi-Couch geschrieben hat, nur anschließen. Das Washington-Dekret kann man nicht guten Gewissens empfehlen. Zu dick sind die Kröten der Unglaubwürdigkeit, die Adler-Olsen uns hier vorsetzt, als dass man sie alle schlucken könnte. Einige ganz passable actionreiche Szenen in der zweiten Hälfte des Romans retten den insgesamt verkorksten Plot auch nicht mehr. Zumal das Finale wieder zu schön ist, um wahr zu sein.